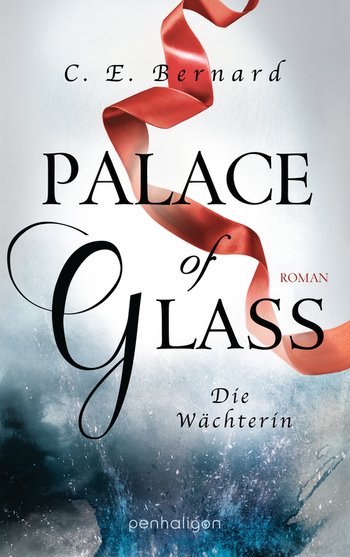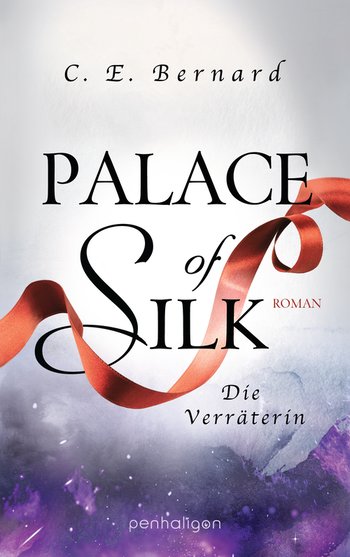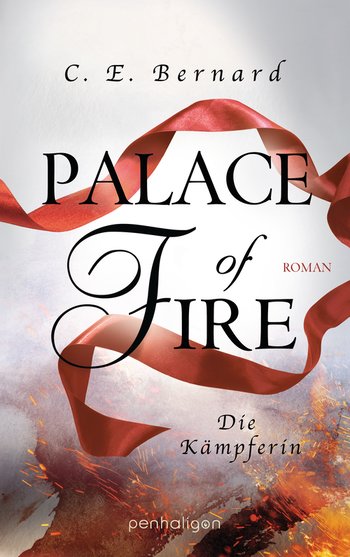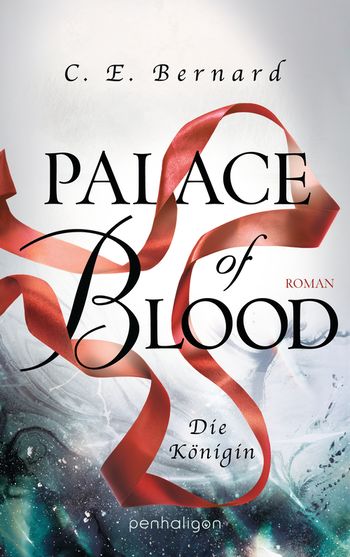Die "Palace"-Saga von C. E. Bernard
Sie muss das Leben des englischen Thronfolgers retten – doch sie ist sein größter Feind …
London: Die junge Rea wächst in einer Welt auf, in der die Berührung nackter Haut verboten ist – wer gegen das Gesetz verstößt, wird bestraft! Niemand nimmt sich das so sehr zu Herzen wie Rea, denn das Gesetz wurde wegen Menschen wie ihr verabschiedet: Sie ist eine sogenannte Magdalene, durch Hautkontakt kann sie die Gedanken und Erinnerungen anderer lesen und beeinflussen. Sorgsam bewahrt sie ihr Geheimnis; doch als sie als Leibwächterin zum Schutz des Prinzen angeheuert wird, scheint ihr Schicksal besiegelt. Die leidenschaftliche Romanze, die sich bald zwischen Rea und Robin entspinnt, macht es für Rea doppelt gefährlich: Weder darf sie sich enttarnen, noch verlieben – und niemals darf sie dem Verlangen erliegen und Robin berühren …
C.E. Bernard ist das Pseudonym von Christine Lehnen, die 1990 im Ruhrgebiet geboren wurde und seitdem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Paris gelebt hat. Sie studierte die Fächer English Literatures and Cultures und Politikwissenschaft, seit 2014 lehrt sie Literarisches Schreiben an der Universität Bonn. Daneben promoviert sie an der University of Manchester über Neuerzählungen des Trojanisches Krieges, erwandert das Siebengebirge und mentoriert zukünftige Talente für PAN e. V. Ihre Kurzgeschichten wurden mit den Literaturpreisen der Jungen Akademien Europas und der Ruhrfestspiele Recklinghausen ausgezeichnet, ihre Romane waren für den RPC Fantasy Award und den Lovelybooks-Leseraward nominiert. Christine Lehnen schreibt auf Englisch – ihre auf Deutsch erschienenen Werke, darunter die Palace-Saga und zuletzt die Wayfarer-Saga, werden ins Deutsche zurückübersetzt.
Mehr zur Autorin erfährst Du unter: http://de.cebernard.eu/
Zu ihren Büchern
Eine Nachricht von C.E. Bernard an Dich
Kapitel 1
Keinerlei Berührung. So lautet das oberste Gebot, das uns von
Kindesbeinen an eingebläut wird, die einzige Regel, die wirklich
von Bedeutung ist. Trage stets deine Handschuhe.
Ich werde diese Regel jetzt brechen.
Obwohl ich es nicht möchte. Noch während sich der erste
Schlag meinem Gesicht nähert, wünschte ich, ich könnte eine
andere sein, irgendjemand, ganz egal, wer. Jemand, der sich
nicht so quält, nicht so kaputt ist.
Der Lärmpegel ringsum steigt an, das Gejohle und die Pfiffe
werden lauter und lauter. Das Untergeschoss des Lovely Molly
ist voller Menschen. Die Männer tragen Wollmäntel und Filzhüte,
die Frauen Hosenträger und typisch englische Melonen
auf den Köpfen. Genau wie ich haben sie sich die Brust abgebunden,
denn eigentlich dürften wir gar nicht hier sein. Natürlich
erkennt uns trotzdem jeder, aber solange der Schein gewahrt
bleibt, drückt man gern mal ein Auge zu.
Die Menge stinkt nach Bier und harter Arbeit, aber das
ist noch harmlos gegen den Geruch, den ich bald verströmen
werde. Schließlich kämpfen die nicht gegen Mister Zwei-Meter-
Zehn – so lautet der Kampfname meines heutigen Gegners, ein
Mann mit flauschig weichem Bart und Armen, die mir ohne
die geringste Anstrengung das Genick brechen könnten. Der
blonde Hüne ist ungefähr in meinem Alter, also noch keine
zwanzig, und wäre ich ihm auf der Straße begegnet, hätte ich
ihn vermutlich ganz attraktiv gefunden. Aber ich bin nicht hier,
um ihm einen Antrag zu machen. Ich bin hier, um zu kämpfen.
Zwei-Meter-Zehn versucht erneut, mich zu erwischen.
Schnell ducke ich mich weg und weiche nach hinten aus. Lautstarkes
Buhen zeugt vom Unmut der Menge, aber insgeheim
sind die Zuschauer erfreut. Niemand hat sein Geld auf mich
gesetzt, auf das blasse, schmale Ding, das nichts vorzuweisen
hat außer seinem Mut. Wieder schlägt Zwei-Meter-Zehn zu.
Diesmal beuge ich mich seitlich weg. Zwei-Meter-Zehn setzt
mir nach. Ich weiche so hastig zurück, dass ich aus dem Tritt
gerate und mit dem Rücken gegen den Ring stoße, der hier aus
einem hölzernen Geländer besteht. Spitze Splitter bohren sich
in meine Haut. Dann werde ich von hinten gepackt, mehr und
mehr Hände umklammern meine Schultern. Sofort fallen die
Erinnerungen über mich her: vergilbte Fliesen, Lederhandschuhe,
der scharfe Knall einer Peitsche. Die Menge schubst mich so
heftig zurück in den Ring, dass ich fast das Gleichgewicht verliere.
Zwei-Meter-Zehn lacht kurz auf, dann, als ich an ihm
vorbeitaumele, verpasst er mir einen Klaps auf den Hintern.
Die Menge jubelt. Gedemütigt bleibe ich stehen. Ich hätte
nicht herkommen sollen. Trotzdem fahre ich herum, um mich
meinem Gegner zu stellen. Der nähert sich langsam, leckt sich
mit der Zunge über die Lippen. Seine Hände sind nackt, genau
wie meine. Ich spüre, wie sich mir die Kehle zuschnürt. Er
kommt immer näher. Ich müsste nur die Hand ausstrecken.
Doch ich zögere. Ich darf dem dunklen Verlangen nicht
nachgeben.
Es ist jetzt sechsundzwanzig Jahre her, dass die Berührung
nackter Haut in Großbritannien für gesetzeswidrig erklärt wurde.
Denn vor sechsundzwanzig Jahren hat man Menschen wie
mich entdeckt, woraufhin unser König den NPA, den National
Protection Act, ratifiziert hat: Körperliche Berührungen sind nur
noch verheirateten Paaren gestattet, und auch das nur zum
Zwecke der Fortpflanzung. Aber selbst diese Angelegenheit
wird mit so wenig Körperkontakt wie möglich erledigt. Alles
wegen der Menschen, die so sind wie ich.
Zwei-Meter-Zehn stößt ein leises Knurren aus. Dann rennt
er los, streckt die Arme aus, will mich am Hals packen. Der
Anblick seiner nackten Finger ist faszinierend – etwas zu faszinierend.
Er erwischt mich an der Schulter, schleudert mich einmal
quer durch den Ring. Der Aufprall schürft mir die Haut
auf, lähmender Schmerz schießt durch meinen Rücken. Wieder
grölt die Menge begeistert. Und schon ist Zwei-Meter-Zehn
über mir, tritt mich in den Bauch. Ich muss würgen. Der nächste
Tritt drückt mir die Luft aus der Lunge. Der Mann trägt
Stiefel mit schweren, scharfkantigen Sohlen. Hustend versuche
ich, seinen Tritten auszuweichen. Wegzukriechen. Aber er ist
schneller als ich.
Eine große Hand packt meine Haare, bis die schwarzen
Strähnen zwischen den Fingern hervorquellen. Als er mich
hochzieht, schreie ich laut auf, schreie immer weiter, während
er mich durch den Ring schleift. Lachend feuern die Zuschauer
ihn an. Für sie ist es das perfekte Spektakel, und Zwei-Meter-
Zehn ist sich dessen bewusst. Als er mich auf die Füße stellt
und anfängt, meinen Brustkorb mit Fäusten zu bearbeiten,
wird mir kurz schwarz vor Augen. Da weiß ich, dass ich nicht
länger warten darf.
Für das Publikum muss es so aussehen, als wäre ich einmal
mehr gestolpert. Ich ducke mich kurz, sodass der nächste Schlag
nicht auf meiner Brust, sondern am Unterkiefer landet.
Sobald seine nackte Haut auf meine trifft, spüre ich die Explosion
in meinem Bewusstsein. Sein Geist breitet sich wie auf
einer mächtigen Welle in mir aus, ich fühle seine erstaunliche
Kraft, atme ihn, nehme ihn in mich auf wie das reine Leben.
Und ich kann ihn sehen: sein gesamtes Bewusstsein, sämtliche
Gedanken, die ihm durch den Kopf schießen. Er ist voll auf
den Kampf konzentriert, plant den nächsten Angriff. Will mit
der linken Hand meinen schmalen Hals packen und zudrücken,
bis ich keine Luft mehr bekomme, ihn anflehe, bis mein
Gesicht so blau wird wie meine Augen …
Aber beim Kämpfen geht es nicht um Kraft. Es geht darum,
dem Gegner immer einen Schritt voraus zu sein.
Zwei-Meter-Zehn hat rechts seine Deckung vernachlässigt,
was ich mir nun zunutze mache. Ich ramme ihm die Faust gegen
den Kiefer. Das Publikum quittiert meinen Angriff mit
Pfiffen. Der Hüne taumelt kurz, geht aber sofort wieder auf
mich los. Ich lasse ihn ein Stück weit herankommen, dann
springe ich vor und ziele auf seinen Solarplexus. Auch jetzt
muss es so aussehen, als hätte ich ihn verfehlt, deshalb erwische
ich nur sein Schlüsselbein, aber sobald ich ihn berühre, erkenne
ich, dass er mein Bein anvisiert.
Mit einem Schritt weiche ich seitlich aus und trete ihm mit
voller Kraft gegen die Kniescheibe, was ihn von den Füßen
holt. Das laute Knacken begeistert die Menge.
Dafür bin ich hergekommen, habe mich als Mann verkleidet,
riskiere mein Leben, breche einem anderen Menschen die
Knochen: um ein fremdes Bewusstsein zu spüren. Ich umklammere
den Hals meines Gegners, setze mich auf seinen Rücken
und drücke sein Gesicht in den Staub. Zwei-Meter-Zehn wehrt
sich heftig, schlägt um sich. Jetzt berühren wir uns richtig. Es
ist berauschend. Wie ein sanftes Streicheln rinnt der Schweiß
über meine Haut. Unerbittlich halte ich den Hünen fest, spüre,
wie er schwitzt, rieche ihn, fühle jede seiner Blessuren und höre
seine Gedanken: Wie kann das sein, dass ich gegen diese mickrige
Makrele verliere? Ich brauche das Geld unbedingt. Er stellt sich
vor, wie wir wohl gerade aussehen, die kleine, schmale Gestalt
auf seinem Rücken, die schlanken Beine, die seine Hüften umklammern,
die bloßen Hände an seinem nackten Hals. Mich
überfällt so heftige Scham, dass ich fast losgelassen hätte. Stattdessen
verdränge ich das Gefühl mit aller Macht, was mich fast
mehr Kraft kostet als der Klammergriff um Zwei-Meter-Zehns
Hals.
Sobald ich zum Sieger erklärt werde, lasse ich ihn los. Einen
Moment lang herrscht drückendes Schweigen, dann bricht jemand
in Jubelrufe aus und skandiert meinen Kampfnamen:
Roter Kardinal. Niemand hier kennt mich als Rea Emris, und
das muss auch so bleiben.
So schnell ich kann, klettere ich von Zwei-Meter-Zehn herunter.
Das Triumphgefühl verfliegt sofort. Am liebsten wäre
ich ganz woanders, aber ich muss warten, bis Zwei-Meter-Zehn
aufgestanden ist, damit wir uns die Hände reichen können.
Betreten
starre ich auf meine Füße, blicke überall hin, nur nicht
an die Wände dieses düsteren, feuchten Lagerhauses am Fluss
oder gar in die aufgeheizte Menge, die sich fast schon geifernd
einen Kick verschafft, indem sie uns dabei beobachtet, wie wir
gegen das Gesetz verstoßen. Und ganz sicher nicht auf Mister
Zwei-Meter-Zehn, dessen Geist mir selbst aus dieser Entfernung
noch verstohlen zuzuflüstern scheint.
Das Getöse der Menge brandet erneut auf, als Zwei-Meter-
Zehn sich erhebt und ich ihm die Hand hinstrecke. Sobald
unsere
Finger sich berühren, hämmern noch einmal seine
Gedanken
auf mich ein: Ich habe verloren. Wie konnte ich nur
verlieren? Sieh sie dir doch an. Wiegt keine fünfzig Kilo, die Kleine.
Er kneift die Augen zusammen, und ich sehe den Schmerz, der
sich in seine Gedanken schleicht. Sein Stolz ist am Boden. Von
einem Mädchen geschlagen. Schon jetzt weiß ich, was er als
Nächstes denken wird. Denn jemand wie er kann nur auf diese
eine Idee kommen. Und was, wenn … was, wenn sie eine Mag-
dalena ist? Nur so kann sie mich überhaupt besiegt haben. Sie
muss eine Magdalena sein.
Panik steigt in mir auf, und während ich verstohlen nach
Luft ringe, verstärkt sich mein Griff um seine Finger. Er will
seinen Arm zurückziehen, aber ich klammere mich weiter an
seine Hand, strecke meine geistigen Fühler aus und dringe in
seine Gedanken ein. Hektisch radiere ich das eine Wort aus,
verwische es, bis Magdalena nicht mehr zu erkennen ist. Doch
das reicht nicht. Ich muss ihm einen neuen Gedanken eingeben,
ihn in eine andere Richtung lenken.
Also schiebe ich ihm den einen Begriff unter, der nah genug
dran ist.
Schlampe.
Ich kann sehen, wie seine Gedanken sich umformen. Wie
konnte ich gegen die verlieren? Sie ist eine Frau, das sieht doch
jeder.
Ich wette, sie ist eine richtige Schlampe. Seht sie euch doch
an. Nur Schlampen zeigen ihre nackten Hände.
Ruckartig entzieht er mir seine Hand, und die Verbindung
zu seinen Gedanken reißt ab. Als er mir anschließend vor die
Füße spuckt, bin ich nur froh, dass er nicht auf mein Gesicht
gezielt hat.
Wie immer ziehe ich mich schnellstmöglich aus dem Ring
zurück, weiche den Schulterklopfern aus, will keine Anerkennung.
Nicht für das, was ich gerade getan habe. Es war ein
Risiko,
das ist mir bewusst. Nachdem ich meine Verkleidung in
den Rucksack gestopft habe, ziehe ich mich an. Dabei achte ich
vor allem darauf, meine Gladiés korrekt anzulegen, die festen
Handschuhe, die bis zu den Ellbogen reichen. Anschließend
folgt der hohe gestärkte Kragen, der meine Wangen bis zu den
Augen hinauf schützt. Marienkragen wird er genannt. Zu guter
Letzt schlinge ich mir den Kummerbund, einen breiten Ledergürtel,
um die Taille und schiebe hinten am Rücken die Hände
hinein. Dieses Kleidungsstück soll dafür sorgen, dass unsere
Hände immer schön dort bleiben, wo sie hingehören, und ist
damit der wichtigste Teil eines jeden Outfits.
Kummerbund und Gladiés,
trage sie, wohin du gehst,
ob bei Arbeit oder Spiel,
unser Schutz sei stets dein Ziel.
Schließlich verlasse ich das Gebäude über eine Treppe, die zu
einer Falltür im Hinterhof hinaufführt. Vollkommen respektabel
gekleidet, trete ich auf die Straße hinaus. Ich zittere am ganzen
Körper. Deshalb lehne ich mich für einen Moment gegen
den Rahmen der Tür, stehe reglos da, mit dem Rucksack über
der Schulter. Versuche, mich nicht an den Empfindungen zu
berauschen, die noch in mir nachschwingen. An dem Gefühl,
in Zwei-Meter-Zehns Bewusstsein zu dringen. Als würde jemand
ganz sanft über meine Nerven streicheln, meinen Verstand
in eine feste, friedliche Umarmung hüllen, zärtlich und
doch voller Halt. Für mich ist dies das überwältigendste und
gleichzeitig natürlichste Gefühl der Welt. Nur so kann ich ganz
ich selbst sein.
Ja, wegen Menschen wie mir wurde damals der National Protection
Act verabschiedet. Wenn ich die nackte Haut eines anderen
berühre, kann ich ihm nicht nur in den Kopf schauen
und seine Gedanken lesen, ich kann sie sogar verändern.
Ich bin eine Magdalena.
Etwas Weiches streicht um meine Beine, verräterisch sanft.
Es ist die Kreatur, die wie immer aus dem Nichts aufzutauchen
scheint. Grau ist sie, pelzig, ein bisschen so wie ein Hund, aber
größer. Das ist nicht real, hat mein Vater gesagt. Sie existiert nur
in deinem Kopf. Meine Mutter umklammerte bei diesen Worten
ihr Küchenmesser so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten.
Und sie erwiderte, dass die Kreatur in meinem Kopf existiere,
müsse noch lange nicht heißen, dass sie nicht real sei.
Abgrundtiefe Müdigkeit überkommt mich, und ich stoße
mich von dem Türrahmen ab. Die Kreatur drückt von hinten
die Schnauze in meine Kniekehlen. Sie ruft mir die tiefe Finsternis
in Erinnerung, die in meinem Inneren herrscht. Drängt
mich auf die vielen Brücken zu, beschreibt mir flüsternd die
Schönheit des eisigen Wassers. Ich versuche, ihr nicht zuzuhören.
Erschöpft ziehe ich eine Hand aus dem Kummerbund
und hole mein Handy hervor, um auf die Uhr zu sehen. Liam
wird bald nach Hause kommen. Ich muss zurück. Außerdem
wäre es nicht sonderlich klug, noch länger hierzubleiben. Man
weiß schließlich nie, welche Straßen gerade überwacht werden.
Ich wende mich vom Fluss ab und tauche in das dunkle
Gewirr
der vielen kleinen Gassen ein, die wir Heilige Höfe nennen.
Keine Ahnung, warum dieses Viertel so heißt. Zwar gibt es
einige Hinterhöfe, aber ein Heiliger würde sich bestimmt nicht
dorthin verirren.
Ich hole eine Maske aus meinem Rucksack, eine Colombina,
mit der ich meine obere Gesichtshälfte bedecke. Spätestens seit
dem Anschlag auf den Kronprinzen in der vergangenen Woche
maskiert sich wirklich jeder, der die Heiligen Höfe besucht.
Dem Thronfolger ist nichts passiert, aber sein Bodyguard wurde
getötet. Die Attentäterin war eine Magdalena. Sie wurde an
Ort und Stelle erschossen. Ich habe immer noch das Bild ihrer
langen blonden Haare auf dem blutverklebten Straßenpflaster
vor Augen. Seitdem haben die Presse und die GVK – die Guard
of Virtuous Knights – eine brutale Hetzjagd auf sämtliche
Rechtsbrecher eröffnet. Überall sonst wären Masken vollkommen
undenkbar, aber die Heiligen Höfe bilden eine Ausnahme.
Natürlich würde das nie jemand offen zugeben, aber es ist eine
unausgesprochene Tatsache, dass so viele Adelige in dieses Viertel
kommen, um im Schutz ihrer Masken gewisse Bedürfnisse
zu befriedigen, dass selbst die GVK angehalten ist, diese Art
der Verkleidung nicht vollständig zu verbieten. Und doch wurden
ungeschriebene Gesetze wie dieses in letzter Zeit öfter ausgehebelt.
Seit dem Attentatsversuch auf den Prinzen hat sich
die Zahl der Razzien spürbar erhöht. Der Anschlag hat die
Ängste unzähliger Bürger geschürt, war aber auch eine Blamage
für die Königliche Garde. Vor allem, da nur wenige Monate
zuvor, nach einem ähnlichen Angriff auf die Königin, ein neuer
Captain angeheuert wurde, dessen Ernennung lautstarken Protest
hervorrief: der Weiße Ritter, ein Elitekämpfer aus Frankreich.
Er nennt sich selbst Blanc und ist eine Art Legende in
den schäbigen, vor Dreck starrenden Arenen und unter uns
heimlichen Straßenkämpfern. Mit siebzehn galt er als unangefochtener
Meister der illegalen Faustkämpfe in Paris und wurde
dann bei den Mousquetaires aufgenommen, der Königlichen
Garde Frankreichs. Im Gegensatz zu mir hat er seine Kämpfe
stets fair gewonnen.
Während ich am Flussufer entlanglaufe, zupfe ich immer
wieder nervös an meiner Maske, um ihren Sitz zu überprüfen.
Ich trage das Ding nur ungern, genau wie meine Handschuhe.
Unter ehrbaren Leuten verhüllt man seine Hände ab einem
Alter
von drei Jahren. Eine meiner frühesten Erinnerungen
dreht sich genau darum: Mein Vater schenkt mir ein Paar
Handschuhe zum Geburtstag, nur wenige Monate bevor ich in
die Vorschule komme. Es ist ein sonniger, aber kalter Tag, und
wir stehen mit einigen aufgeregt schnatternden Kindern auf
unserer Veranda, wo ich meine Geschenke auspacke … Damals
lebten wir noch in den USA, wo ich auch geboren wurde. Mein
Vater hatte wirklich schöne Handschuhe aus Lammfell für
mich ausgesucht. Anfangs glitten sie wie Wasser über meine
Haut, aber dann schloss er sie mit einem Druckknopf. Meine
Finger waren noch nicht kräftig genug, um ihn wieder aufzumachen.
Ich fing an zu weinen. Mein Vater sagte, ich solle mir
keine Sorgen machen, er würde sie mir abends aus- und am
Morgen wieder anziehen, und dann nahm er mich ganz fest in
den Arm. Ich weiß noch, wie mein großer Bruder Liam mir die
Hand auf die Schulter legte. Und wie meine Mutter uns beobachtete.
Sie war eine große, elegante und starke Frau. Da sie
Engländerin war, hatten wir einen kuriosen Akzent, der nirgendwo
so richtig reinpasste. An jenem Tag trug sie ebenfalls
Handschuhe, die sie von meinem Vater bekommen hatte –
rotes
Leder, sehr hübsch. Aber vor allem ist mir der Ausdruck
auf ihrem Gesicht in Erinnerung geblieben. Eigentlich hätte ich
es damals schon wissen müssen. Vielleicht hätte ich sie dann
beschützen können …
Ich spüre es erst, als ich um die Ecke biege. Eine Art Schauer.
Als würde mir jemand mit den Fingerspitzen über das Genick
fahren. Hastig drehe ich mich um, aber die Gasse hinter mir ist
leer – nichts als schwarzes Kopfsteinpflaster und dunkle Ziegelmauern,
die von einer einzigen Straßenlaterne angestrahlt werden.
Dann tauchen die Scheinwerfer einer Luftkissenbahn auf,
die schnell und beinahe lautlos vorüberzieht. Ich lausche angestrengt,
höre aber nur leise Geigenklänge, die vom Fluss heraufwehen.
Und selbst dieses Geräusch klingt durch den Nebel
irgendwie
dumpf. Ganz langsam setze ich meine Kapuze auf. Es
muss wohl die Kälte gewesen sein, oder ich habe mir die Berührung
eingebildet. In ganz London gibt es niemanden, der mich
anfassen würde.
Erst als ich den Kopf hebe, um weiterzugehen, entdecke ich
die Gestalt.
Gute fünfzig Meter entfernt steht jemand auf dem Bürgersteig.
Ich kann lediglich eine große, dunkle Silhouette erken-
nen. Sie rührt sich nicht. Während ich langsam weitergehe,
versuche ich mich möglichst selbstbewusst zu geben. Falls es
sich um einen Ritter der GVK handelt, könnte dies mein letzter
Tag in Freiheit gewesen sein. Bereits am Tag der Ratifizierung
des NPA wurde auch die Guard of Virtuous Knights
gegründet.
Die Königliche Garde wurde diesen tugendhaften
Rittern unterstellt. Beide Institutionen werden gefürchtet, vor
allem von meinesgleichen.
Ich gehe an dunkel gestrichenen Häusern vorbei, deren steile
Dächer an die strenge Miene einer Anstandsdame gemahnen.
Die schwarzen Vorhänge lassen kein Licht durch. Lediglich
die Haustüren unterscheiden sich voneinander: rot, grün, gelb,
alles ziemlich grell wie zu dick aufgetragenes Make-up. Auch
das erinnert mich an Anstandsdamen. Angespannt zupfe ich an
meinen Handschuhen, während ich die Silhouette vor mir
nicht aus den Augen lasse. Kein Millimeter nackter Haut darf
zu sehen sein. Seit es den NPA gibt, ist man im Vereinigten
Königreich zum sittsamen Kleidungsstil des neunzehnten Jahrhunderts
zurückgekehrt, obwohl wir bereits das Jahr 2054
schreiben.
Genau wie in Amerika sieht man überall hypermoderne
Handys und Tablets, doch diese Gerätschaften werden
in altmodischen Ledertaschen oder absurd voluminösen Unterröcken
verborgen.
Inzwischen habe ich die Gestalt fast erreicht. Ich kann sie
nur aus den Augenwinkeln beobachten, da es Frauen nicht gestattet
ist, Männer offen zu mustern. Und das hier muss ein
Mann sein, auch wenn er einen weiten Mantel mit Kapuze
trägt, sodass ich nichts Genaues erkennen kann. Fünf Meter
noch. Augen geradeaus. Vier. Drei. Zwei. Eins.
Während ich an ihm vorbeigehe, bemerke ich einen leichten
Duft: Bergamotte, vermischt mit einer rauchigen Holznote.
Irgendwie
berauschend. Er zeigt keine Reaktion, als ich meinen
Weg fortsetze und befreit Luft hole. Mir war nicht einmal
bewusst,
dass ich den Atem angehalten habe.
Erst nachdem ich fünfzig Schritt Distanz zwischen uns
gebracht
habe, drehe ich unauffällig den Kopf. Und bemerke
hinter mir eine Bewegung.
Er folgt mir.
Ich warte nicht, zögere keine Sekunde, sondern renne um
mein Leben.
Bloß weg von der Gestalt, immer tiefer hinein in die verwirrenden
Gassen der Heiligen Höfe. Ich hetze auf eine Reihe
hoher
Häuser zu, die sich verzweifelt an vergangener Größe
festklammern, während ringsum der Verfall herrscht. Finster
ragen ihre Portale vor mir auf. Ich biege um eine Ecke, sehe
mich hastig um. Falls er mich verfolgt, hat er es noch nicht bis
zur Ecke geschafft. Ich kann es also riskieren. Ich springe über
einen niedrigen Zaun und laufe auf die nächste Tür zu. Meine
Faust knallt schneller gegen das nasse Holz, als ich mitzählen
kann. Zwei, zwei, eins.
Die Tür öffnet sich. Ich stürme an dem blassen Jungen vorbei,
Mollys Sohn Meram, der hinter mir sofort wieder zumacht.
»Lass niemanden rein«, zische ich noch, bevor ich weiterlaufe.
Durch den Flur, zur Hintertür hinaus, in einen großen
Hof, der voller Dampf ist. Da er durch ein Glasdach am Abziehen
gehindert wird, kann ich im ersten Moment nichts sehen.
Entgeistigter Dampf noch mal! Der weiße Nebel steigt aus den
Trögen der Weber auf, die überall auf dem Hof ihrer Arbeit
nachgehen. Mit ihm werden die Raupen abgetötet, die zuvor
sorgsam mit Maulbeer- und Eichenlaub aufgepäppelt wurden,
um das eine Material zu produzieren, nach dem wir uns alle
verzehren: Seide. Die Droge der Magdalenen, die einzige Medizin
gegen unser Verlangen. Jeder Magdalene hungert nach
menschlichem Kontakt – körperlich wie auch mental. Wir nen-
nen es Hautgier und Geistgier. Seide kann zwar den Geist nicht
befriedigen, aber in ihrer Ursprungsform lindert sie das Bedürfnis
nach Hautkontakt. Deshalb ist in der Öffentlichkeit nur
verarbeitete Seide gestattet: Brokat, Chiffon, Satin. Aber hier
auf diesem Hof trägt jeder Seide, entweder als weiches Band
direkt am Körper, als Umhang oder in Form einer Maske.
Ich drossele mein Tempo gerade so weit, dass ich weder mit
den Webern noch mit ihren Trögen oder den Seidenbändern
zusammenpralle, die überall in der Luft flattern. Einen Herzschlag
lang lasse ich den Blick schweifen. Dies ist Babylon. Hier
verscherbeln Magdalenen ihren Geist an den Meistbietenden.
Nachdem ich mich an den Dampf gewöhnt habe, kann ich
den Hof besser überblicken, mustere die hölzernen Buden und
den großen Pfahl im Zentrum. Der steht schon seit Menschengedenken
dort, geschnitzt aus dem Stamm eines uralten Baumes.
Ganz oben sind vier verschiedene Seidenbänder angebracht,
für jede Kaste der Magdalenen ein Band und eine Farbe:
ganz unten Violett für die Schnüffler. Darüber das Grün der
Maltoren. An zweiter Stelle von oben weht das gelbe Band der
Memextratoren. Und ganz oben das Blau der Mensatoren. Früher
wehte darüber noch ein fünftes, ein in stolzem Rot leuchtendes
Band aus Feuerseide, aber das ist verschwunden.
Ich halte auf den Pfahl zu, schiebe mich an altbekannten
Buden und diskret versteckten Touchdisplay-Telefonzellen vorbei.
Neben wundervollen Seidenstoffen liegen hier auch Romane
und Theaterstücke in der Auslage, gut getarnt durch
Koch- oder Gebetbuchumschläge. An den Ständen sind ebenfalls
bunte Seidenbänder angebracht, anhand derer man erkennen
kann, welche Magdalenenkaste hier ihre Dienste anbietet.
Zuerst komme ich bei den Maltoren vorbei, deren grüne Bänder
an duftende Nadelwälder erinnern. Einer von ihnen ist
gerade
mit einem Kunden beschäftigt. Sein langer KapuzenBernard_
mantel hüllt ihn vollständig ein, nur für einen Moment sehe
ich seine bloße Hand aufblitzen, bevor sie die Stirn des Kunden
berührt. Dieser stöhnt leise. Schnell gehe ich weiter. Maltoren
sind die Meister der Emotionen und des Schmerzes. Wenn sie
nackte Haut berühren, können sie Leid von den Menschen
nehmen, es ihnen aber auch zufügen. Was von beidem hier gerade
der Fall ist, weiß ich nicht, aber in Babylon sollte man nie
zu viele Fragen stellen.
Als Nächstes kommen die Buden mit den gelben Bändern
der Memextratoren, kurz Memexe genannt. Sie können tief in
das Bewusstsein eintauchen und Erinnerungen hervorholen,
damit man sie ungetrübt betrachten kann. Das dient sowohl
dem Vergnügen als auch therapeutischen Zwecken. An dem
Stand, an dem ich gerade vorbeilaufe, drückt der Memex – eine
Frau, würde ich sagen – lediglich die Fingerspitzen auf einen
schmalen Streifen nackter Haut am Handgelenk seines Kunden,
auf dessen Gesicht sich daraufhin die reinste Wonne abzeichnet.
Was auch immer vor seinem geistigen Auge abläuft, es
muss besseren Zeiten entstammen.
Mit einem prüfenden Blick versuche ich herauszufinden, ob
ich die Memex kenne. In Babylon nennt man keine Namen, es
sei denn, man hängt nicht gerade an seinem Leben. Aber ich
habe hier früher einmal mit einer Memex und einer Maltorin
zusammengearbeitet. Manchmal wirken ein Mensator und ein
Memex im Team, um den Kunden vergessen zu lassen, woran
er sich nicht mehr erinnern will. Ich hingegen werde niemals
die vielen Gesichter vergessen, die an unserem Stand auftauchten.
Die Soldaten, die uns anflehten, ihnen die grausamen Erinnerungen
zu nehmen. Die meisten von ihnen konnten sich
unsere Dienste nicht leisten, trotzdem taten wir für sie, was wir
konnten. Einmal halfen wir sogar einer Adeligen. Sie war ungefähr
sechzig und versuchte mit feinstem Make-up und funkeln-
dem Schmuck die Wunden auf ihrer Seele zu verbergen. Einer
ihrer blaublütigen Freunde hatte sie in ihrem eigenen Haus vergewaltigt.
Es gab niemanden, an den sie sich damit wenden
konnte – niemanden außer uns. Also berührten wir ihre nackte
Hand, und die Maltorin linderte den Schmerz, während die
Memex die entsprechenden Erinnerungen aufspürte und ich sie
veränderte. Es gelang uns, die Frau den Großteil ihres Leids
vergessen zu lassen, was zur Folge hatte, dass sie uns wüst beschimpfte,
als sie wieder zu sich kam. Sie konnte sich nicht
mehr daran erinnern, warum sie überhaupt hergekommen war.
Und trotzdem genoss ich jede Sekunde davon. Als die
Memex mich berührte, erfasste mich eine wahre Flut von Erinnerungen.
Während die Maltorin meine Hand nahm, wurden
meine Emotionen so viel lebendiger. Und wenn ich die Gedanken
der Menschen las, die Gedanken dieser Frau … oh, Maria,
es gibt für mich keinen größeren Genuss, als in den Geist eines
anderen einzutauchen. Doch wenn ich es tue, ist mir stets bewusst,
was das zur Folge haben kann – das Knallen der Peitsche,
die Hände auf meinem Körper, das leise Flüstern: Schlampe.
Ruckartig setze ich mich wieder in Bewegung, laufe hastig an
den grünen und gelben Buden vorbei. Als die Stände mit den
violetten Bändern auftauchen, zwinge ich mich, ein normales
Lauftempo einzuschlagen. Hier arbeiten die Schnüffler. Diese
Magdalenen fürchten wir anderen fast noch mehr als die GVK,
denn sie spüren es, wenn jemand in ihr Bewusstsein eindringt.
Berührt man ihre nackte Haut, um ihre Gedanken, Erinnerungen
oder Gefühle zu durchleuchten, erkennen sie, was man ist.
Sie erschnüffeln es regelrecht. Wir anderen verfügen nicht über
diese Fähigkeit. Falls mich ein Maltor oder ein Memex berühren
würde, wäre ich vollkommen ahnungslos.
Blaue Bänder sehe ich an diesem Abend keine, anscheinend
bin ich heute der einzige Mensator in Babylon. Wir sind sozuBernard_
sagen aktive Beobachter: Wann immer wir nackte Haut berühren,
erleben wir alles mit, was sich in dem jeweiligen Bewusstsein
abspielt: Gedanken, Bilder, Geräusche, Gerüche … Zu
Erinnerungen und Emotionen habe ich keinen direkten Zugang,
aber zu den Gedanken, die sich mit ihnen befassen. Zu
sämtlichen Gedanken. Dabei ist jeder Geist anders, sie sehen
alle vollkommen unterschiedlich aus. Manche Menschen denken
in Bildern, andere in Worten. Meistens setzt sich das
Bewusstsein
aus einer Mischung verschiedener Sinneseindrücke
zusammen. Doch vor allem sind wir Mensatoren die Einzigen,
die in den Geist eingreifen und Gedanken manipulieren können
– der Name ist eigentlich eine Kurzform des Begriffs Mensipulator.
Diese Form unserer Erbsünde ist die seltenste und
gleichzeitig die tückischste. Wird ein Magdalene aufgegriffen,
ist das allein schon ein Festtag für das ganze Königreich. Doch
erwischen sie einen Mensator, ist das ein Riesentriumph, fast so
als hätten sie einen Krieg gewonnen.
Inzwischen habe ich die dunkelste Ecke von Babylon erreicht.
Hier ist der Dampf nahezu undurchdringlich, der Geruch von
heißer Seifenlauge und Schwefeldioxid hängt über allem. Ich
beschleunige meine Schritte wieder, als ich an den Magdalenen
mit den silbernen Masken vorbeikomme, an Marias Megären.
Sie warten hier darauf, für die Menschenjagd engagiert zu werden:
Berühre den Feind, dringe in seinen Geist ein, manipuliere
ihn, lasse ihn leiden, malträtiere sein Bewusstsein, bis er sich in
den Wahnsinn flüchtet. Auch sie tragen die bunten Bänder ihrer
jeweiligen Kaste, aber ich schaue vorsichtshalber nicht allzu genau
hin.
Es juckt mich in den Fingern, als ich mit langen Schritten
auf die Mauer zulaufe, die Babylon nach hinten hin abgrenzt.
Am liebsten würde ich bleiben, aber das Risiko ist zu groß. Die
Magdalenen sind nicht wirklich organisiert, dieser Innenhof ist
nicht geschützt. Hier kämpft jeder für sich allein. Jeder einzelne
Augenblick in Babylon ist ein Wagnis. Jede Minute, in der man
Seide am Körper trägt, erhöht das Risiko, entdeckt zu werden.
Jeder Atemzug könnte dein letzter sein. Deshalb laufe ich weiter,
ziehe mich an den Efeuranken der Mauer hoch, lasse mich
auf der anderen Seite fallen und federe mit schmerzenden
Knien
den Sturz ab. Dann renne ich weiter, immer weiter. Als
ich schließlich die Rückseite des Gebäudes erreiche, in dem die
Wohnung meines Bruders liegt, haben das Adrenalin und die
Schuldgefühle mich schon fast untergekriegt. Über die Feuerleiter
klettere ich zu meinem Fenster hoch und schiebe mich
möglichst lautlos hindurch.
Mein Zimmer ist klein und beherbergt eigentlich nur ein einfaches
weißes Bett, einen Kleiderschrank und einen Schminktisch
mit Spiegel. Letzterer ist heutzutage Standard, damit wir
alle sorgfältig darauf achten können, wie wir uns kleiden. Ich
verstecke mein Kostüm unter den Stoffballen in meinem Kleiderschrank
– weicher Chiffon, festes Leder, raue Wolle. Was zu
meinem Beruf als Schneiderin passt, allerdings bewahre ich
diese
Stoffe hier auf, um sie berühren zu können, wenn die
Hautgier unerträglich wird. Es ist nicht vergleichbar mit dem
Gefühl, in einen Geist einzutauchen, nicht einmal mit Seide
auf der Haut, aber in meinen dunkelsten Momenten ist es besser
als gar nichts.
Nun schiebe ich eine Hand unter die schweren Ballen und
taste nach meinem Seidenband. Eigentlich müsste es blau sein,
die Farbe der Mensatoren, aber dieses Band habe ich nicht in
Babylon erstanden. Nein, die Seide gehörte früher meiner Mutter
und davor meiner Großmutter. Sie stammt noch aus einer
Zeit, als Seide von allen Menschen getragen wurde, nicht nur
von Magdalenen. Damals hatte meine Großmutter ihr eigenes
Geschäft und webte die schönste Seide, die man sich vorstellen
konnte. Überall auf der Welt waren ihre Stoffe gefragt. Feuerseide
wurde sie genannt, da das Licht wie eine Flamme über das
Gewebe zu tanzen schien. Doch das war natürlich vor der Seidenrebellion.
Bevor die Magdalenen in den Untergrund verbannt
wurden.
Vorsichtig hole ich das Band hervor. Die rote Seide schimmert
zwischen meinen Fingern. So ein Band zierte früher die
oberste Spitze des Pfahles in Babylon, bevor die Feuerseide so
selten und wertvoll wurde, dass sie jemand stahl. Sanft gleitet
mein Finger über das weiche Material, das sich herrlich glatt
und kühl anfühlt. Bevor ich schlafen gehe, binde ich es mir
immer um den Hals, damit der Drang morgens beim Aufwachen
nicht schon so stark ist, dass ich es nicht bis abends
aushalte. Aber das funktioniert nicht immer. Heute war einer
dieser Tage.
Ich hole mir eine Schüssel mit Wasser, stelle sie auf meinen
Schminktisch und wasche mir hastig den Dreck und den
Schweiß ab. Liam darf nicht erfahren, wo ich gewesen bin. Er
weiß über meinen Zustand Bescheid, und er hat alles aufgegeben,
um mein Geheimnis zu bewahren. Es wäre ein weiterer
Punkt in meinem langen Sündenregister, würde ich ihm das
verdanken, indem ich mich bei meinen Ausflügen von der
GVK oder von der Presse erwischen ließ. Ich ziehe mein Hauskleid
an, richte den hohen Kragen, streiche die Schleppe und
den bodenlangen Saum glatt. Dann stecke ich das Seidenband
in die eine Rocktasche, die Handschuhe in die andere. Hier in
der Wohnung muss ich sie nicht tragen. Anschließend lege ich
mein Handy neben das Tablet auf meinem Nachttisch und
gehe
in die Küche hinüber. Es ist still in der Wohnung. Ich
gönne mir einen Moment mit dem Brotteig, den ich auf dem
Fensterbrett stehen gelassen habe. So tief wie möglich vergrabe
ich meine Finger in der weichen Masse. Das wird ein hervorragendes
Brot werden. Wie gerne würde ich mich selbst verformen
wie diesen Teig. Jemand anderen aus mir machen. Es ist
unfassbar – dieselben Finger, die jetzt mit pudrigem Mehl bedeckt
sind, haben sich vor nicht einmal einer Stunde so fest in
Zwei-Meter-Zehns Hals gebohrt, dass sie bestimmt Spuren
hinterlassen haben. Nur eine Stunde, schon widert mich der
Gedanke daran an. Und zugleich wünschte ich, ich könnte es
wieder tun.
Während ich noch mit mir hadere, höre ich leise Schritte im
Treppenhaus. Dann klickt das elektronische Türschloss.
»Rea, ich bin zu Hause.«
Sekunden später betritt mein Bruder die Küche. Er ist drei
Jahre älter als ich, hat leuchtend rote Haare und unglaublich
lange, schlanke Finger. Gedankenverloren zupft er an den Saiten
seiner Violine. Die Kälte hat sein Gesicht gerötet, seine
Nägel
schimmern bläulich. Weil er weiß, dass er mir damit eine
Freude macht, schenkt er mir ein Lächeln, doch seine Miene
bleibt ernst, während er Schal, Mütze und Mantel ablegt. Er
stellt eine Papiertüte mit Weißbrot, Eiern und Milch auf den
Küchentisch. »Heute hatte niemand besondere Lust auf Musik
«, entschuldigt er sich. »Morgen werde ich mir einen anderen
Platz suchen müssen.« Nachdem er die Violine vorsichtig weggelegt
hat, geht er zum Herd und nimmt eine der Pfannen, die
an Haken an der Decke hängen. »Arme Ritter?«
»Mein Leibgericht«, versichere ich ihm und sehe zu, wie er
mit ruckartigen Bewegungen das Brot aufschneidet. Liam erinnert
mich an unsere Mutter – ruhig, aber stark. Seit sie verschwunden
ist und seit dem Tod unseres Vaters vor vier Jahren
hat er sich um mich gekümmert. Er hat keinem von beiden
verziehen, dass sie uns verlassen haben. Doch er hat mich bis
hierher nach London mitgenommen, um einen ganzen Ozean
zwischen uns und unsere Vergangenheit zu bringen, und hat
seitdem die kältesten vier Jahre seines Lebens durchlitten.
Aber nun wird sich wieder alles ändern. Liam hat sich um ein
Stipendium an der Königlichen Musikhochschule von Paris beworben,
um dort Konzertgeige zu studieren. Und ich will ihn
in die Stadt der Lichter begleiten. In Nordamerika und dem
Vereinigten Königreich stehen Berührungen aller Art unter Strafe,
aber auf dem Kontinent nicht. Wir hätten schon längst die
Insel verlassen und wären nach Irland oder Frankreich gegangen,
irgendwohin, wo ich nicht verfolgt würde, aber eine Auswanderung
ist heutzutage nahezu unmöglich. Alle, die es versucht haben
– auf schäbigen Flößen oder auf dem Dach der wenigen
Züge, die noch durch den Tunnel fahren –, sind nie wieder aufgetaucht.
Oben im Norden ist es sogar noch schlimmer, am
ehemaligen Hadrianswall. Der heißt jetzt Marienwall, benannt
nach dem einzigen Kind von Katharina von Aragon und der
meistverehrten Monarchin aller Zeiten, Königin Maria I. Sie
ist die jungfräuliche Herrscherin, das makellose Vorbild aller
Frauen.
Ihr Porträt hängt in jedem Haushalt, immer direkt
neben
dem ihrer Namenspatronin, der Heiligen Jungfrau.
Aber wenn Liam nach Paris gehen würde, könnten wir vielleicht
auch ein Visum für mich bekommen. Ich habe mich sogar
schon nach Arbeit umgesehen, träume von einer Anstellung
in der Grande Bibliothèque oder dem Théâtre Odéon. Bücher
waren schon immer mein größter Trostspender und das Theater
die reinste Erlösung. Noch heute sehe ich unser Schultheater
vor mir, spüre den schweren roten Vorhangstoff zwischen den
Fingern, rieche die Schminke, erinnere mich an die weichen
Knie kurz vor dem ersten Auftritt. An die Freude, den Adrenalinkick,
die befreiende Möglichkeit, jemand anders zu sein –
mein größter Wunsch von allen.
Doch ich erinnere mich auch an harte Fliesen und die kalte
Luft auf meiner nackten Haut, wenngleich ich das lieber vergessen
würde.
Mein Bruder schaltet das Radio ein. Er ist kein besonders
visueller Mensch, das grelle Licht von Bildschirmen und Neonröhren
irritiert ihn. Deshalb besitzen wir auch keinen Fernseher.
Im Radio läuft gerade ein Werbespot der Regierung.
»Denkt immer daran, ihr Jungen und Männer dort draußen«,
ertönt die umwerfende Stimme von Thea Mallory. »No skin,
no sin.« Die Adelige vermietet ihr klangvolles Organ regelmäßig
an die Regierung – um des Ruhmes willen. Und damit ist sie
tatsächlich sehr berühmt geworden. Inzwischen spitzt jeder
brav die Ohren, wenn sie spricht. »Der Weg zur Hölle führt
über die Haut.«
Liam switcht durch die Sender, bis er ein klassisches Konzert
findet – ein Pianist spielt eine wehmütige, leichte Melodie.
Automatisch
passt Liam seine Bewegungen an, er schneidet
jetzt langsamer, rhythmischer, mit weniger Druck. Der Magie
der Musik kann er sich nie entziehen. Es dauert nicht lange, bis
er sich hin- und herwiegt. Ich muss grinsen. Er ist ein grauenvoller
Tänzer. Ich nehme die Hände aus der Teigschüssel, halte
sie hoch und ahme Liams Bewegungen nach. Sobald er es bemerkt,
steigern wir uns beide rapide, bis wir nur noch wild mit
den Armen zucken. Falls einer der Nachbarn jetzt zu uns hereinsieht,
glaubt er wahrscheinlich, wir hätten einen simultanen
Krampfanfall. Liam lacht laut auf, als ich ein paar selbst erfundene
Ballettschritte aufführe und dabei fast das Gleichgewicht
verliere.
»Oh, Maria, haben sie dir in der Schule denn gar nichts beigebracht?
«
»Nichts Nennenswertes. Außer natürlich, dass man das
Abendessen nicht anbrennen lassen darf«, schieße ich zurück.
Schon hat Liam sich ein Küchentuch geschnappt und schlägt
damit nach mir. Ich setze mich mit der langen Schleppe meines
Hauskleides zur Wehr. Über den Küchentisch hinweg fechten
wir es aus, laut lachend, nur unterbrochen von überraschtem
Quietschen, wenn einer von uns einen unvermutet heftigen
Treffer landet. Der Kampf findet erst ein Ende, als Liam tief
Luft holt und die Nasenflügel bläht. Er beugt sich weit über die
Tischplatte. »Riecht es hier etwa verbrannt?«
Wieder lachen wir los. Während Liam zum Herd stürzt, um
das Essen zu retten, widme ich mich weiter meinem Teig. Er ist
fast so weich wie die Seide, die ich in Babylon gesehen habe.
Ob es in Paris wohl auch ein Babylon gibt? Bestimmt. Früher
war das schließlich kein Schwarzmarkt, sondern ein Ort des
Wissens, der Forschung und der Andacht. In ganz alter Zeit gab
es sogar eine ganze Stadt mit diesem Namen; schließlich existierten
die Magdalenen schon immer. Unser Babylon ist nur
noch ein Schatten seiner selbst, nichts als ein schäbiger Hinterhof,
in dem Kriminelle ihre lasterhaften Dienste an alle verscherbeln,
die es sich leisten können. Niemand weiß, wer den
Markt leitet und die Genehmigungen für die Buden und
Webertröge
erteilt. Meram dient als Sprachrohr, und Molly
zieht am Ende des Geschäftstages siebzig Prozent der Einkünfte
ein, aber es weiß niemand, an wen sie das Geld weitergibt. Das
alles ist natürlich absolut illegal. Der alte Holzpfahl, die vier
Farben – nichts als dürftige Überreste einer Zeit, in der Magdalenen
noch nicht als Abschaum galten. Als ihre Existenz allgemein
bekannt war und die Menschen wussten, dass man sich
hilfesuchend an sie wenden konnte. Doch die Zeit der Hexenverfolgung
hat dem ein Ende gemacht. Um den gnadenlosen
Hinrichtungen, den Scheiterhaufen und dem nassen Tod in
Seen und Flüssen zu entgehen, tauchten die Magdalenen unter,
bis sich keine Menschenseele mehr daran erinnern konnte, dass
sie existierten.
Bis wir erneut entdeckt wurden. Bis zur Seidenrebellion. Bis
vor sechsundzwanzig Jahren.
Aber in Paris wird alles anders sein. Ganz bestimmt.
Als ich später ins Bett gehe, kreisen meine Gedanken noch immer
um Paris. Ich knipse meine Nachttischlampe aus und stelle
mir vor, wie ich Arm in Arm mit meinem Bruder am Ufer der
Seine entlangspaziere, während der Fluss im Licht der Sterne
fröhlich funkelt. Da summt plötzlich der Vibrationsalarm meines
Handys. Seufzend nehme ich das Gerät in die Hand. Wahrscheinlich
ist es eine Nachricht von Róisín, die mich früher zur
Arbeit bestellt.
Es ist nicht Róisín.
Es ist eine Nachricht, aber mit unterdrückter Nummer.
Träum schön.
Dich erwische ich noch.
Ruckartig setze ich mich auf. Meine Finger schließen sich
krampfhaft um die Bettdecke, während mein Blick zum Fenster
huscht. Der Boden ist eiskalt, als ich aufstehe. Schaudernd
schleiche ich zum Fenster, gehe tief in die Hocke und schiebe
dann vorsichtig die weißen Vorhänge auseinander, nur einen
kleinen Spalt weit.
Und sehe gerade noch, wie die Gestalt in dem weiten Mantel
die Straße hinuntergeht.
Jetzt bestellen
Kapitel 1
Die Straßen des Quartier Latin sind heute noch so eng wie in
alter Zeit und ebenso düster. Ich gerate auf den nassen Pflastersteinen
ins Rutschen, während ich im prasselnden Regen
um mein Leben laufe. Drei Verfolger. Ich zähle ihre Schritte.
Sie sind schnell. Die Jagd drängt mich fort von den belebten
Boulevards am Fluss in immer dunklere Gassen hinein, wo die
Laternen kaputt oder erst gar nicht vorhanden sind. Ich biege
um eine Ecke. Häuser mit verrammelten Fensterläden, nur drei
Stockwerke hoch. Ich sollte springen, auf ein Fensterbrett hechten,
ein Regenrohr hinaufklettern. Vielleicht aufs Dach. Aber
mein Rücken tut immer noch weh, und meine von Blutergüssen
übersäten Beine zittern. Ich kann nichts anderes tun, als
weiterzulaufen. Was ich in Paris zu finden gehofft habe, weiß
ich nicht. Falls es Frieden war, hätte ich wohl nicht weiter danebenliegen
können. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich es nicht
anders verdient habe. Immerhin habe ich gegen die Regeln verstoßen.
Damit kommt man nicht so einfach davon.
Dann erkenne ich, dass ich in einer Sackgasse gelandet bin.
Nichts ist so schwarz wie eine Mauer, auf der ein imaginäres Aus
und Vorbei prangt.
Ich warte nicht ab, bis ich gegen die Ziegel pralle, versuche
nicht, über die Mauer zu klettern. Stattdessen drehe ich mich
um und hebe die mit Verbänden umwickelten Fäuste. Meine
Knöchel sind noch nicht verheilt. Mit den Zähnen reiße ich die
Verbände ab. Sofort setzen brennende Schmerzen ein, schießen
durch meine Finger. Aber nur so habe ich eine Chance – mit
bloßen Händen.
Die drei Verfolger sind am Eingang der Gasse stehen geblieben.
Vielleicht wollen sie den Moment auskosten. Jetzt haben
sie mich. Nichts und niemand steht ihnen im Weg. Hier gibt
es nur das fahle Licht des Mondes und die dicken Regentropfen
auf unserer Haut. Der Mann auf der rechten Seite hat ein
vernarbtes Gesicht, der Linke ballt bereits die Fäuste. Doch es
ist die Gestalt in der Mitte, die mir einen kalten Schauer über
den Rücken jagt. Diese Frau war der Grund dafür, dass ich losgerannt
bin, sobald ich die drei entdeckt habe. Sie trägt eine
Maske – silbern wie das Mondlicht, aus leichtem Metall, das
einem Gesicht nachempfunden ist. Wie die von Marias Megären,
jenen Magdalenen, die auf andere angesetzt werden, um
ihnen unerträgliche
Schmerzen zuzufügen oder sie Befragungen
zu unterziehen, die im Wahnsinn enden.
Die Megäre ruft mir etwas zu. Durch das laute Prasseln des
Regens verstehe ich kein Wort. Ich will es auch gar nicht. Schon
als die drei auf mich zukamen, verborgen unter dunklen Capes,
haben sie so getan, als wollten sie nur mit mir reden. Aber ich
weiß, wann man sich besser aus dem Staub macht. Narbengesicht
und Faust treten einen Schritt vor. Sie kommen. Ich atme
durch den Schmerz. Dann greife ich an. Meine Sohlen trommeln
auf das Kopfsteinpflaster, der Regen schlägt mir ins Gesicht. Ich
halte auf die Megäre zu. Ziele auf ihre Kehle. Schon jetzt brennen
meine Beine, und überall an meinem Körper pochen schlecht
verheilte Wunden. Viel Zeit bleibt mir nicht für einen Sieg. Narbengesicht
und Faust brüllen etwas, während sie sich vor die
Megäre schieben. Ich katapultiere mich voran. Narbengesicht
bückt sich, greift an seinen Stiefel. Zieht ein Messer. Ich lache
laut auf. Adrenalin schießt durch meine Adern. Dann werfe ich
mich in eine Drehung und sehe gerade noch, wie Narbengesicht
die Augen aufreißt. Die Klinge gleitet über meinen Brustkorb, als
ich sie mit dem Schwung meines Körpers aus dem Weg schiebe.
Ein heißes Rinnsal läuft über meine Haut. Wenn er meint,
Schmerzen würden mich aufhalten, sollte er sich mal meinen
Rücken ansehen. Meine Arme. Meinen Geist.
Ich pralle mit meinem ganzen Gewicht gegen Narbengesicht.
Das reicht aus, um ihn von den Füßen zu reißen. Ineinander
verkeilt landen wir auf dem Boden. Sofort versuche ich,
nackte Haut zu berühren, egal wo, aber ich werde von hinten
gepackt. Faust hebt mich hoch. Als er die Finger in meinen
Rücken bohrt, schreie ich gequält auf. Er kann die Spuren der
Auspeitschung nicht sehen, aber ich spüre sie. Ruckartig reiße
ich den Ellbogen nach hinten, nehme ihm die Luft zum Atmen.
Er lässt mich los. Schnell wirbele ich herum und schlage blind
in Richtung seines Solarplexus. Der Treffer entlockt ihm ebenfalls
einen Schrei, allerdings weniger laut als meiner. Es fühlt
sich an, als wären meine Knochen zersplittert. Die Schmerzen
nehmen mir die Sicht. Trotzdem ist er derjenige, der aus dem
Gleichgewicht gerät. Das ist meine Chance. Mein Körper mag
zu schwach sein, um die beiden zu schlagen, aber mein Geist ist
es nicht. Ich packe Fausts Cape und nutze mein eigenes Körpergewicht,
um uns herumzuwirbeln. Als er Narbengesicht direkt
gegenübersteht, werfe ich mich gegen ihn. Er fällt hin, ich mit
ihm. Gemeinsam reißen wir Narbengesicht mit.
Hastig rappele ich mich auf. Meine Knochen knirschen gequält,
meine Muskeln brennen. Ich strecke beide Hände nach
ihren Gesichtern aus. Nach ihrer nackten Haut. Sobald ich sie berühre,
werde ich in ihr Bewusstsein geschleudert. Ihre Gedanken
strömen wie eine Droge durch meine Adern. Die von Faust sind
exakt aufgereiht – klar, karg, genau abgewogen. Wie ein endloses
silbernes Band gleiten sie unter meiner linken Hand entlang.
Unter der rechten drängen sich die von Narbengesicht zusammen
wie die Ladung eines vollgepackten Güterzuges, Gedanke
über Gedanke. Sein Bewusstsein klingt auch so, ein lautes, chaotisches
Rauschen drängt sich in meinen Geist, der instinktiv zurückweicht.
Ich zwinge mich, nicht nachzugeben. Die mentalen
Wunden, die ich mir beim letzten Kampf zugezogen habe, reißen
wieder auf. Ich denke an meinen Bruder, an meine Freunde, die
bestimmt schon auf mich warten, und für den Bruchteil einer
Sekunde auch an jenen, der es sicherlich nicht tut.
Mit brutaler Gewalt zwänge ich einen Gedanken nach dem
anderen in Narbengesichts Geist, bis ich spüre, dass er fast platzt.
Gleich darauf wende ich mich Fausts ordentlicher
Gedankenkette
zu. Bei ihm muss ich nur die Ränder etwas ausfransen. Ich schiebe
ihm etwas unter, was nicht von ihm stammt. Nur einen einzigen
meiner Gedanken. Schwarz statt Silber. Ein falscher Flicken in
dem perfekten Band. Dann spüre ich, wie ihre Körper unter meinen
Händen anfangen zu zucken. Bewusstseinsschock. Das wird
sie lange genug außer Gefecht setzen, damit ich verschwinden
kann. Und all das hat nicht länger als einen Atemzug gedauert.
Ich stemme mich auf meine malträtierten Knie hoch. Ein
Krampf erfasst meinen Körper. Blut verklebt meine Kleidung.
Doch mir bleibt keine Zeit. Komm schon, flehe ich stumm.
Komm schon! Diesmal brülle ich es, während ich schwankend
aufstehe. Aber ich schaffe es. Ja, ich schaffe es.
Zu spät.
Verhüllte Finger schließen sich um meinen Nacken.
Die Megäre steht hinter mir.
Ihre Hand drückt auf meinen Mantelkragen, zwingt mich
nach unten, wieder auf die Knie. Durch den Stoff erahne ich
ihren Geist, wie ein leises Wispern aus der Ferne. Er flüstert mir
etwas zu, genau wie ihre Stimme. »Du hast Schmerzen.«
Diese Stimme. So weich.
»Ihr Auftraggeber wird das sicher gerne hören«, presse ich
hervor, dann beiße ich wieder die Zähne zusammen, um den
Schmerz unter Kontrolle zu halten.
Die Megäre scheint zu zögern. Ich höre nur ihren Atem. Und
das Prasseln des Regens auf dem Pflaster. Das leise Klatschen,
wenn er auf meine Haut trifft.
»Tatsächlich?«
Es ist kalt und nass. Ich zittere. Die Hand in meinem Nacken
ebenfalls, für einen kurzen Moment, bevor die Megäre fortfährt:
»Bist du eine visionnaire?«
»Eine was?« Das verwirrt mich. Eine Frage? Von einer Megäre?
Was ist aus ihrem Motto geworden: Erst schießen, dann fragen?
Ein leises Geräusch dringt an mein Ohr, fast wie ein Seufzen,
nur trauriger. Es klingt vertraut. Oder liegt das am Regen, den
harten Steinen unter meinen Knien, der Erniedrigung, auf allen
vieren zu hocken? »Du würdest Magdalena sagen.«
Ich schließe die Augen. Wie sehr ich dieses Wort gefürchtet
habe. Magdalena. »Das ist kein Verbrechen.« Hier nicht. Anders
als in England, meinem Heimatland, aus dem ich gerade erst
geflohen bin. Nicht hier in Paris, wo ich dem Hass entkommen
wollte.
»Ja oder nein?«
Ich könnte es sagen. Sollte es sagen. Schlagartig wird mir
bewusst, dass es das erste Mal in meinem Leben wäre. Zum
allerersten Mal würde ich zu dem stehen, was ich bin. Rea
Emris, Mensatorin, Gedankenformerin. Wenn ich Hautkontakt
mit einem anderen Menschen habe, kann ich seine Gedanken
lesen und sie verändern. Hier ist das nicht illegal. Hier könnte
ich frei sein.
Aber mein Geist steht in Flammen, mein Rücken brennt höllisch,
und meine Knie können kaum noch mein Gewicht tragen.
Ich will auf Nummer sicher gehen. Also schweige ich. Am
Rand meines Gesichtsfeldes blitzt etwas auf. Der Dolch liegt
an meiner Kehle, bevor ich mich auch nur rühren kann. Beim
Schlucken spüre ich die Klinge. Es fließt kein Blut. Noch nicht.
Nur ein kalter Druck auf der Haut.
»Antworte.«
Ich verlagere mein Gewicht. Diese Waffe macht mir auch
nicht mehr Angst als die von Narbengesicht. Es wird wehtun,
aber ich kann es schaffen. Glaube ich.
Die Megäre keucht überrascht, als ich mich gegen ihren
Dolch lehne. Ihre Finger lockern sich, rutschen über den Griff.
Ich trete nach hinten aus, treffe mit der gesamten Stiefelsohle.
Regen und Dunkelheit verschlucken den leisen Schmerzensschrei,
doch ich bin bereits aufgesprungen und renne los. Am
Ausgang der Gasse entscheide ich mich blind für eine Richtung,
die mich hoffentlich zum Fluss führt. Eine Straße fliegt an mir
vorbei, dann noch eine. Ich höre Stimmen. Sie folgen mir nicht,
kommen eher von vorne. Vielleicht bilde ich mir das aber auch
nur ein. Ein Geruch steigt mir in die Nase. Blumen? Ich bin mir
nicht sicher. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Plötzlich
muss ich wieder an den anderen Kampf denken. Erst vor drei
Tagen habe ich den König von England und seinen treuesten
Ritter besiegt – geistig wie körperlich. Oh Mann, ich habe echt
nachgelassen. Ich gerate ins Stolpern. Ein Licht kommt auf mich
zu. Hoffentlich ist es das am Ende des Tunnels und nicht der heranrasende
Zug, denke ich noch, dann verliere ich das Bewusstsein.
Als ich wieder zu mir komme, ist es wesentlich wärmer und
trockener. Ich kuschele mich unter meine Decke. Sie ist nicht
besonders weich, aber gemütlich. Ein Feuer knistert, und ich
höre Stimmen. Vertraute Stimmen.
»Was hat sie da draußen getrieben?«
»Keine Ahnung. Kleiner Mondscheinspaziergang?«
»Findest du das etwa lustig?«
»Oh ja, und wie.«
»Sicher, es waren ja auch nicht deine Nähte, die ruiniert wurden.«
»Welch ein Jammer. Die Welt der Kunst hat ein Meisterwerk
verloren.«
»Ich werde dich an dieses Gespräch erinnern, wenn du das
nächste Mal irgendwo blutend auf der Straße liegst.«
»Das würdest du niemals tun.«
»Dein Gesicht wäre heute jedenfalls wesentlich hübscher,
wenn ich schon immer für dich da gewesen wäre.«
»Narben sind sexy, wusstest du das nicht?«
»Messieurs«, schaltet sich eine dritte Stimme ein. »Sie wacht
gerade auf.«
Als ich die Augen aufschlage, blicke ich in das Gesicht des
Comte. Er lehnt neben der Tür an der Wand, in der schwarzblauen
Uniform der Mousquetaires, der französischen Palastwache
und Polizei.
»Miss Emris.« Er klingt ruhig wie immer, hält sich aufrecht
wie immer, sieht mich finster an wie immer. Mein Erinnerungsvermögen
ist demnach nicht beeinträchtigt. Das ist gut.
»Comte.« Ich versuche mich aufzusetzen, ändere meine Pläne
aber, sogar noch bevor René an meine Seite eilt, um mich daran
zu hindern.
»Schön langsam, Mademoiselle.« Renés attraktives Gesicht
verzieht sich mitfühlend, als er mich langsam zurück auf die
Matratze sinken lässt. Im Gegensatz zum Comte trägt er keine
Uniform, sondern nur ein Hemd. Er hat dunkle Ringe unter
den Augen, die er mit einem charmanten Lächeln zu kaschieren
versucht, und sein sonst immer sorgfältig gestutzter Bart wirkt
ein wenig zerzaust. Während der vergangenen drei Tage hat er
jede freie Minute damit verbracht, Ninons und meine Wunden
zu heilen, die körperlichen
wie die geistigen, die wir im Kampf
gegen den König und seinen tapfersten Ritter davongetragen
haben. Es tut immer noch weh, an die beiden zu denken. An
den König von England und Mister Galahad.
An den Prinzen.
Also tue ich es nicht. Und ich sehe René nicht in die Augen,
dessen ganze Pflege gerade in einer dunklen Gasse von zwei
Schlägertypen und einer Megäre zunichtegemacht worden ist.
Wir befinden uns in seiner Wohnung. Ich erkenne es an den
Möbeln aus Ahornholz, auf denen überall Kerzen stehen, ebenso
wie an der Wäscheleine, die quer durch das Zimmer gespannt ist
und an der immer etwas zum Trocknen hängt. Ein Grammofon
spielt leise Jazzmusik, dazu singt jemand einen deutschen Text.
Aus der Küche dringt der verlockende Geruch eines deftigen
Wintergerichts herüber: Fenchel, Oliven, Kapern und Knoblauch.
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
Renés Arzttasche steht geöffnet auf dem Tisch, Nadel und
Faden stecken in seinem Gürtel. Neben meiner liegen noch zwei
weitere Matratzen im Raum. Eine von ihnen ist leer. Dort sollte
eigentlich Ninon liegen. Auf der anderen hat sich Blanc ausgestreckt
wie ein müder Bär. Ein mit ziemlich vielen Verbänden
umwickelter Bär, aber trotzdem ein Koloss. Ich beobachte, wie
seine Brust sich hebt und senkt. Seine nackte Haut, die den warmen
Braunton von Tee mit Milch hat, spannt sich über seinen
Muskeln, durchzogen von hellen Narben und dunklen Wunden,
sowohl frischen als auch älteren. Als ich in sein Gesicht
sehe, wird mir klar, dass er meine Blicke bemerkt hat. Vielleicht
irre ich mich ja, aber ich könnte schwören, dass er rot wird.
Blanc hebt eine träge Pranke von seiner Uniformjacke, die
ihm als zusätzliche
Decke dient, und sagt: »Du machst es ganz
richtig, mein Hase. Einen anständigen Kampf sollte man sich
nie entgehen lassen.«
»Du weißt wirklich, wie man mit Damen umzugehen hat,
Blanc«, seufzt René und zwinkert mir zu. Dann drückt er einen
Kuss auf meine nun wieder aufgeplatzten Knöchel. Er ist wirklich
ein Charmeur. Vorsichtig streicht er mit den Fingerspitzen
über meine Verletzungen. Bei jeder Berührung schnappe ich
kurze Gedankenfetzen auf: … ist nur geschehen – wir werden alles
neu machen müssen – was ist nur los in dieser Sta … Als er schließlich
eine Hand an meine Wange legt, flattern seine Lider kurz.
Er überprüft, ob ich auch geistige Wunden davongetragen habe.
»Was ist passiert?« Der Comte hat die Arme vor der Brust
verschränkt. Mir ist nicht entgangen, dass er eine Waffe bei sich
hat. Die hat er nicht mehr abgelegt, seit wir hier angekommen
sind – Blanc, Ninon und ich, blutverschmiert und verletzt, am
Rande des Zusammenbruchs.
Ich befeuchte meine trockenen Lippen, während ich meine
Gedanken ordne. Dann erzähle ich ihnen von dem Besuch bei
meinem Bruder Liam, den ich viel zu lange nicht mehr gesehen
habe. Dem Rückweg von seiner kleinen Wohnung unten bei der
Moschee, ganz in der Nähe des Jardin des Plantes im 5. Arrondissement.
Wie ich mich verlaufen habe. Wie ich, beim Blick in
das Schaufenster eines Schneiders, dessen gewagte Entwürfe man
nur bewundern kann, bemerkt habe, dass ich verfolgt werde.
»Sie waren zu dritt. Und ich glaube, die Frau war eine
Megäre.«
»Eine was?«, fragt René.
»Eine Magdalena, die man zur Befragung und Folterung seiner
Feinde anheuern kann. In London gab es viele von ihnen, in
Babylon«, erkläre ich ihm.
»Barbarisch«, murmelt René, während Blanc ihm einen kurzen
Blick zuwirft und dann an den Comte gewandt fragt: »Megären?
In Paris?«
»Das wäre die Erste seit Jahren«, erwidert der Comte. Noch
immer vollkommen gelassen sieht er mich an. Egal was kommt,
er hat sich stets unter Kontrolle. »Eine Patrouille hat dich bewusstlos
in der Rue Santeuil gefunden. Sie haben dich erkannt
und hierhergebracht. Ich werde diesen Vorfall gleich morgen
Früh dem Capitaine melden.«
»Das war doch nichts weiter«, protestiere ich. René zuckt
zusammen, denn er spürt meine Verlegenheit ebenso wie meine
Schmerzen. Er ist ein Maltor, ein Magdalene, der nicht die
Gedanken, sondern die Emotionen anderer lesen und verändern
kann. Langsam, ganz subtil lässt er ein Gefühl der Geborgenheit
in meinen Geist fließen. Sein Bewusstsein hüllt mich
ein wie eine weiche Decke. Ein himmlisches Gefühl. Als wäre
ich nach einem Spaziergang in einer bitterkalten Winternacht
nach Hause gekommen und hätte mich mit einem Becher Tee
an den prasselnden Kamin gesetzt.
»Haben sie dir verraten, was sie von dir wollten?«, fragt er,
während er mich auf die Seite rollt, um meinen Rücken untersuchen
zu können.
»Nein.« Krampfhaft presse ich die Kiefer zusammen, um den
Schmerz zu unterdrücken, der mich aus der Geborgenheit reißt.
»Ich habe dafür gesorgt, dass sie keine Gelegenheit dazu hatten.«
»Und wie?«
Ich schaue zu Blanc hinüber, denn ich will sein breites Grinsen
sehen. »Indem ich ihnen eine Tracht Prügel verpasst habe,
die sie so schnell nicht vergessen werden.« Blanc legt den Kopf
in den Nacken und lacht. Ich liebe dieses Geräusch. Sofort muss
ich daran denken, wie er einmal laut gelacht hat, während wir
kämpften. Damals hat er mich in die Luft gehoben, als wäre das
gar nichts. Einmal habe ich dabei seinen nackten Handrücken
berührt – in England, wo dergleichen streng verboten ist. Noch
heute spüre ich die Wärme seiner Haut und diese unendliche
Weite seines Geistes.
»Gut gemacht, mein Hase.«
Ich schließe die Augen. René nimmt mir nach und nach den
Schmerz, und Blancs Lachen erledigt den Rest. Von der Frage
erzähle ich ihnen nichts. Bist du eine visionnaire? Auch nicht
von meiner Antwort, die keine war. Blanc hat immer noch Albträume
wegen der beiden Wachen, die er in England verloren
hat. Sie wurden getötet, damit wir fliehen konnten. Der Comte
berührt mich nach wie vor nur mit Handschuhen. Und René
ist an meiner Seite und setzt seine überragenden Fähigkeiten
ein, um meine Schmerzen zu lindern. Er soll nicht erfahren,
dass ich eben das verleugnet habe, was uns verbindet, ihn und
mich. Zwei Magdalenen. Mir wäre es am liebsten, wenn wir
alle diesen Vorfall so schnell wie möglich vergessen könnten.
Am besten jetzt sofort. Beim nächsten Mal muss ich einfach
wachsamer sein.
Ich versinke voll und ganz in Renés Behandlung. Als wir
vor drei Tagen hier ankamen, hat Blanc uns zu ihm gebracht,
noch bevor er einen Arzt verständigte. Ninon und ich hatten
gemeinsam die Erinnerungen des englischen Königs manipuliert,
damit er vergaß, dass ich eine Magdalena und sein Sohn,
der Kronprinz, überhaupt nicht sein Sohn war. Dabei hatten
wir unseren Geist restlos ausgebrannt. René warf einen kurzen
Blick auf uns, legte seine Uniformjacke ab, krempelte die
Ärmel hoch und legte jedem von uns eine Hand auf die Stirn,
während der Comte einen Arzt rief. Meine Schmerzen waren
so stark, dass ich überhaupt nicht mitbekam, was um mich
herum geschah. Auch jetzt erinnere ich mich nur noch daran,
dass ich Blancs Hand umklammert hielt, und an das Gefühl,
dass sich jeder Gedanke wie ein Eiszapfen in meinen Verstand
bohrte. René nahm das alles von mir. Davor war ich noch nie
von einem Maltoren behandelt worden, diesem Meister über
Emotionen und Schmerz. Ich wusste nicht, wie sich so etwas
anfühlte. Mir erschließen sich nur die Gedanken der Menschen.
Ihre Gefühlswelt ist für mich das reinste Minenfeld, sie
ist immer in Bewegung, unmöglich zu fixieren. Ihre Schmerzen
sind grausame Strömungen, die mich in die Tiefe reißen und
dort festhalten, bis ich keine Luft mehr bekomme. Doch für
René ist es anders. Er schmolz die Eiszapfen und ließ das Wasser
abfließen. Anschließend flickte er uns wieder zusammen, erst
den Geist, dann den Körper – jeden Kratzer, jede Brandwunde,
jeden noch so kleinen Riss. Genau wie jetzt. Er hüllt meinen
Geist in federleichte Verbände, in warme Decken. Jetzt schlafen.
»Mon cher«, höre ich die leise Stimme des Comte, und es
klingt wie eine Warnung. Aber ich verstehe nicht, was er damit
sagen will. Dazu bin ich viel zu entspannt, viel zu sehr mit meiner
Heilung beschäftigt. Bilder aus der Vergangenheit steigen auf,
flackernd und verschwommen. Meine Mutter. Die Gutenachtgeschichten,
die sie uns zum Einschlafen vorgelesen hat und an
die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Selbst ihr Gesicht
ist im Laufe der Jahre immer undeutlicher
geworden. Ich war
noch klein, als sie uns verließ. Aber das Gefühl ist geblieben,
unverfälscht und gestochen scharf. Das Gefühl, beschützt zu
werden. Behütet. Das Einzige zu sein, was wirklich wichtig ist.
Es klopft an der Tür. Langsam öffne ich die Augen. Noch ein
Klopfen, diesmal lauter. Orientierungslos sehe ich mich um. René
schläft tief und fest, er hat sich neben Blanc zusammengerollt. Der
Comte geht gerade mit erhobenem Rapier zur Wohnungstür.
Schlagartig bin ich wach. Versuche mich aufzusetzen. Dehne
meine Finger. Aua. Es geht. Also ist doch nichts gebrochen,
auch wenn ich sie wohl noch nicht wieder benutzen sollte. Aber
der Comte sieht so aus, als ob …
Schaudernd stelle ich die Füße auf den Boden. Ich trage
lediglich ein Nachthemd, und die sind hier wesentlich kürzer als
in England. Es wird reichen müssen. Während ich angestrengt
auf jedes Geräusch achte, stemme ich mich vorsichtig von der
Matratze hoch. Wieder klopft es, diesmal noch drängender.
»C’est qui?«, ruft der Comte. Wer ist da?
Keine Antwort. Zumindest höre ich nichts. Einen Moment
lang befürchte ich, meine Beine könnten unter mir nachgeben.
Ich atme tief durch – einmal, zweimal – und stütze mich an der
Wand ab. Dann lasse ich los. Balle die Fäuste, atme gegen den
Schmerz an. Schaffe es um die Ecke.
Die Tür erscheint genau in dem Moment in meinem Blickfeld,
als der Comte sie mit erhobener Waffe aufstößt. Es ist
immer noch Nacht, ich kann also nicht allzu lange geschlafen
haben. Das Mondlicht zeichnet tiefe Schatten auf den Hof. In
der Tür steht eine vermummte Gestalt, die in schnellem Französisch
auf den Comte einredet. Der hört reglos zu. Dann stößt
er einen Fluch aus – eines der wenigen Wörter, die Ninon mir
bereits beigebracht hat. Er steckt das Rapier weg und greift nach
seinem Cape. Dabei entdeckt er mich in der offenen Schlafzimmertür.
Überrascht zuckt er zusammen. Wer hätte gedacht, dass dieser
Mann dazu überhaupt fähig ist?
»Was ist los?«, frage ich.
Er wendet sich bereits ab. »Ich muss gehen. Schließen Sie die
Tür hinter mir ab.«
»Und was soll ich den anderen sagen? Wo gehen Sie denn
hin?«
Er zögert, legt kurz die sorgsam bekleidete Hand an den
Türstock. Es dauert beunruhigend lange, bis er leise antwortet:
»Sagen Sie ihnen gar nichts.«
Kerzengerade steht er da, als wäre es ein Kraftakt, sich aufrecht
zu halten, und gleichzeitig seine einzige Möglichkeit. Er
sieht mich an. Dieser Mann gehört zu den Menschen, deren
volle Aufmerksamkeit nur schwer zu ertragen ist. Die so stand-
haft sind, die viel zu genau hinsehen. Für den Bruchteil einer
Sekunde umklammern seine Finger den Türrahmen. Es hat
den Anschein, als wolle er noch mehr sagen. Stattdessen geht er
ohne ein weiteres Wort hinaus.
Kurz überlege ich, ob ich ihm folgen soll. Aber der Adrenalinschub
klingt bereits ab, und mir wird bewusst, dass ich mich
kaum auf den Beinen halten kann. Ich muss mich ausruhen.
Noch immer habe ich das Gefühl, als hätte jemand einen schweren
Vorhang vor meine Gedanken gezogen. Also kehre ich ins
Schlafzimmer zurück und lasse mich wieder auf die Matratze sinken.
Ich spüre das rote Seidenband an meinem Hals. René muss
es mir umgebunden haben, nachdem ich eingeschlafen bin. Als
er es das erste Mal sah, hat er es vollkommen überwältigt angestarrt.
Ich habe nur heftig mit dem Kopf geschüttelt, als er mich
Feuerschwester nannte. Das ist nichts weiter als eine Legende.
Draußen poltern Schritte über das Kopfsteinpflaster. Schwere
Stiefel. Es sind nicht nur zwei Paar, sondern sechs. Nein, acht.
Ich schließe die Augen und hoffe, dass ich bald wieder einschlafe.
Denn bis es so weit ist, wird hinter meinen geschlossenen
Lidern immer wieder ein und dasselbe Gesicht erscheinen.
Der Kronprinz von England. Robin. Wie er meine Hand
nahm und vor einer Schar von Reportern einen Kuss darauf
hauchte, wodurch er alles aufs Spiel setzte. Wie wir gemeinsam
über alberne Vorhänge gelacht und so getan haben, als wären
wir jemand, der wir nie sein könnten.
Wie er herausfand, was ich wirklich bin. Seine Hand an meinem
Hals. Der Hass in seiner Stimme. »Aber das war nicht echt.
Du hast mich das denken lassen. Es war alles gelogen.« Und doch
war er plötzlich da, als ich fast an dem Versuch gescheitert wäre,
die Erinnerungen seines Vaters zu verändern. Sein Geist verband
sich mit meinem zu wahrer Feuerseide, wie in den alten Legenden,
und verlieh mir die Kraft, den Weißen König zu besiegen.
Und wie er mich geküsst hat … als ich ihm anbot, ihn vergessen
zu lassen, genau wie seinen Vater und Mister Galahad. Kurz
vor unserer Flucht. Wie er mir seine Antwort ins Ohr flüsterte:
Wage es ja nicht!
Eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet, noch einmal wirklich
tief einzuschlafen, aber als ich am nächsten Morgen aufwache,
fühle ich mich durch und durch erholt. Sogar die Schmerzen in
meiner Hand sind so gut wie fort. Blanc und René haben mir
eine Nachricht auf dem Küchentisch hinterlassen, zusammen
mit einem Croissant und einem Becher Tee. Sie mussten zur
Arbeit. Einer von ihnen hat neben die Erklärung ein Strichmännchen
gemalt, das sich gerade ein Croissant in den Mund
steckt – oder vielleicht auch aus einem extrem missgebildeten
Becher trinkt, das lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Grinsend
setze ich mich zum Essen an den chaotischen Tisch, auf dem
sich Stoffservietten, Zigaretten und zerlesene Kochbücher stapeln,
bevor ich in dem kleinen Badezimmer verschwinde. Heute
Morgen will ich mich mit Liam am Fluss treffen. Die Sonne
scheint, Renés Wäsche schaukelt in dem leichten Luftzug, der
durch das offene Fenster hereinweht, und es riecht nach Kaffee
und frisch gebackenem Brot. Einen kurzen Moment lang scheinen
die Geschehnisse der letzten Nacht nicht mehr zu sein als
ein böser Traum.
Nachdem ich mich gewaschen habe, ziehe ich den Rattankorb
unter dem Bett hervor, in dem ich meine Kleidung aufbewahre –
beziehungsweise das, was Liam für mich zusammensammeln
konnte. Mein Bruder bewahrt in seiner Wohnung zwar einige
meiner Sachen aus England auf, die er bereits bei seiner Abreise
mit nach Paris genommen hat, aber die wären hier vollkommen
unpassend, weshalb er seine Kommilitonen um ein paar milde
Gaben bat. Ich löse das Band Feuerseide von meinem Hals und
wickele es wieder um meinen Oberschenkel, bevor ich die Sachen
auf dem Bett ausbreite. Noch immer kann ich bei ihrem Anblick
nur staunen. Sie sind so … zwanglos. Nicht dazu gemacht, etwas
zu verstecken, sondern etwas zum Ausdruck zu bringen. Hier finden
sich keine bodenlangen Kleider, keine Kummerbünde, keine
Gladiéhandschuhe oder Marienkragen, die einem die Hände fesseln,
Arme bedecken oder Wangen verhüllen. Stattdessen streiche
ich ehrfürchtig über eine karierte Strickjacke aus Wolle. Über
einen kurzen schwarzen Rock, eng geschnitten. Hier nennt man
das Bleistiftrock. Über Caprihosen aus Seide. Der Stoff schmiegt
sich wispernd an meine Fingerspitzen. Sofort werde ich innerlich
ruhiger. Niemand weiß warum, aber Seide hilft gegen die
Hautgier, die alle Magdalenen überfällt, wenn sie zu lange keinen
Körperkontakt mit anderen hatten. Ich ziehe die Caprihose an,
dazu die Strickjacke und hohe Schuhe mit hübschen Ziernähten,
die René als Budapester bezeichnet. Sich so anzuziehen ist für
mich immer noch ein kleines Wunder – all die leichten Stoffe,
die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Als ich fertig
bin, nehme ich einen kleinen Samtbeutel aus dem Korb und
stelle mich damit vor den Ganzkörperspiegel. Er hat einen edlen
Goldrahmen. Einmal habe ich René gefragt, wie er denn an ein
so wertvolles Stück gelangt sei, woraufhin Blanc und der Comte
nur die Augen verdrehten, während René antwortete, er wolle
lieber keine alten Bettgeschichten auspacken. Diesmal nehme
ich das Gold allerdings gar nicht wahr. Ich habe nur Augen für
die Person im Spiegel.
Das kann nicht ich sein. Nicht diese junge Frau ganz in
Schwarz, deren Beine deutlich zu sehen sind, die Knöchel entblößt.
Die Jacke ist so elegant, die Hose derart gewagt. In England
würde keine alleinstehende Frau es wagen, Schwarz zu tragen,
nicht einmal in den verborgensten Winkeln von Babylon.
Selbst mein Gesicht sieht irgendwie fremd aus. Der Stoff lässt
das Blau meiner Augen dunkler wirken, meinen Hals länger,
meine Wangenknochen markanter. In Paris ist alles irgendwie
extremer. Hier muss ich auch meine Haare nicht hochstecken.
Trotzdem flechte ich mir einen Zopf. Ich fühle mich schon frivol
genug, wenn er über meinen Rücken gleitet.
Anschließend öffne ich den Beutel, in dem sich schmale
Stoffbänder befinden, alle in grellbunten Farben: Pink, Grün,
Gelb. Als ich sie das erste Mal sah, hielt ich sie für eine grelle
Art von Kummerbund, was mir einen ordentlichen
Schrecken
einjagte. Aber dann erklärte mir Liam, dass man diese Bänder
manchettes nennt, was früher einmal so viel hieß wie Überschrift
oder Schlagwort. Und er zeigte mir, wie man sie trägt, nämlich
indem man sie um Arme, Beine oder Hals wickelt, sogar um
Brust, Füße oder Finger. Auf meine Frage hin, welchen Zweck
das habe, antwortete er: zum Spaß. Einfach zum Spaß.
Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich nie irgendetwas
zum Spaß getragen. Ich habe mir angesehen, wie er seine
anlegte, unzählige grüne und rote Bänder über seinen schwarzen
Ärmeln, aber ich bin nicht so wagemutig wie er. Ich entscheide
mich für zwei dunkelblaue Bänder und wickele sie wie
kurze Gamaschen um meine Knöchel und Waden. So halten
sie auch die Kälte ab. In dem Beutel gibt es zudem Schmuck –
manchettes aus Leder, die mit bunten Steinen besetzt sind – und
glitzerndes Make-up. Aber diese Sachen wage ich momentan
noch nicht einmal anzusehen.
Ich reiße mich erst vom Anblick meines Spiegelbildes los, als
mein Handy vibriert. Eine Nachricht von Liam: Komme fünf
Minuten später. Ein Blick auf meine Taschenuhr – ein wunderschönes
Geschenk von Ninon – verrät mir, dass ich noch sehr
viel später dran sein werde als er, wenn ich mich nicht beeile.
Schnell gehe ich in die Küche zurück, streife ein Paar fingerlose
Handschuhe über und lege mir das Cape um, das René mir
geliehen hat. Mäntel oder Jacken scheinen momentan nicht in
Mode zu sein. Dann trete ich in den Sonnenschein hinaus.
Montmartre ist wunderschön. Allerdings nennen die Pariser
dieses Viertel jetzt anders. Améthyste ist sein neuer Name, wie
der strahlend violette Farbton. Améthyste mit seinen langen
Treppen und steilen Kopfsteinpflastersträßchen, in denen das
Leben pulsiert, verschiedene Sprachen erklingen, Menschen
sich begegnen und himmlisches Essen serviert wird. Überall
sieht man kleine Läden wie Schneidereien oder Floristen, in
Brasserien werden Couscous und Tabouleh angeboten, Fromagerien,
Bäckereien und verlockende Patisserien reihen sich aneinander.
Noch nie zuvor habe ich so viel Schokolade auf einmal
gesehen. Die Macarons sind so bunt wie die manchettes in meinem
Beutel. Und erst die manchettes in den großen Geschäften,
die von den Touristen bestaunt werden! Aufstrebende Künstler
tragen die Bänder im Haar, Arbeiter wickeln sie zum Schutz um
ihre Hände. Hier findet man Studenten, Angestellte und Mousquetaires,
rauchende Kellner in Straßencafés, deren Tische voll
besetzt sind. Die Gäste genießen die Wärme von Heizpilzen oder
haben sich in Decken gewickelt. Die meisten von ihnen sind
schwarz gekleidet, aber durch die farbenfrohen manchettes und
das glitzernde Make-up, das von Männern und Frauen getragen
wird, entsteht das bunteste Chaos, das ich je gesehen habe. Die
Erinnerung an den König von England, an seine weiße Uniform
und seine grauen Augen, erscheint hier fast unwirklich.
Der Weiße Hof, der Glaspalast und die stets verschleierte Königin
… nein, so etwas kann doch gar nicht existieren.
Der Prinz. Immer in Schwarz. Seine befehlsgewohnte Stimme,
die mir so oft einen Schauer über den Rücken gejagt hat.
Entschlossen schüttele ich den Kopf und gehe zur Metro. Hier
gibt es nirgendwo aufgemalte Linien, die den Bürgersteig in verschiedene
Spuren unterteilen, auch auf der Straße nicht. Jeder
geht einfach dort, wo es ihm gerade passt. Bis ich den U-Bahnhof
erreiche, habe ich mehr Hände gestreift, als ich zählen kann.
Niemand trägt Handschuhe. Ich komme mir nackt vor, und die
Gedanken der Menschen hängen in meinem Bewusstsein wie
ein Hauch von Parfum auf der Haut. Ça, c’est un beau gosse. Ich
spreche noch kein Französisch, aber oft fange ich Bilder auf. Der
Mann, den die Frau offenbar bewundernd mustert, ist ein Oberkellner
mit schmaler Nase und blauem Glitzer auf den Wangen.
Er steht vor einer Brasserie. Peut-être qu’il vaut mieux de lui apporter
des fleurs – eine alte Dame an einem Blumenstand. Oublié mon
livre – ein gestresst wirkender Herr mit rötlichem
Augen-Makeup.
So schön – ein kleines Mädchen an der Hand des Vaters, das
zu der beeindruckenden Kirche auf dem Hügel hinaufblickt. Sie
ist aus weißem Stein erbaut, aber ihre Fassade verschwindet fast
hinter verschiedenen bunten Bannern. Ganz ähnlich sehen die
hohen Häuser ringsum aus, in denen jeder Vorhang eine andere
Farbe hat, alles außer Weiß oder durchsichtig. Fast meine ich die
Farben riechen zu können … die Farben und die unterschiedlichen
Gedanken. Wenn da nicht noch so viele andere Düfte
wären, wie die frische Winterluft, heißes Mandelgebäck und die
blumigen Aromen von schwarzem Tee.
Nur ein Duft fehlt.
Bergamotte und rauchiges Holz.
Ich schiebe den Prinzen gedanklich so weit von mir weg wie
irgend möglich und gehe hinunter in die Metrostation Améthyste.
Das große Schild leuchtet in genau dem Farbton, nach
dem das Viertel heute benannt ist. Dies ist der Beginn eines
neuen Lebens. Eines Lebens, an dem er keinen Anteil haben
kann. Selbst wenn er es wollte.
Die Metro bringt mich ins Herz der Stadt, zu einer kleinen
Insel in der Seine, diesem glitzernden Band, das sich quer durch
Paris windet. Die Gegend wird Île-de-Corail genannt, und das
Metroschild ist in einem sanften Rotton gestaltet, eben der
Farbe von Korallen nachempfunden. Liam wartet auf der Bank
vor einem alten Laden für englischsprachige Bücher auf mich,
der zwischen einem kleinen Park, dem Fluss und mehreren
windschiefen Häusern eingezwängt ist. Mit einem Becher Tee
in der Hand mustert er die Kathedrale am gegenüberliegenden
Flussufer. Die helle Morgensonne lässt seine roten Haare leuchten,
umschmeichelt seine schmale Gestalt und wärmt das Holz
der Violine in seinem Schoß.
»Guten Morgen, Brahms«, begrüße ich ihn, während ich
mich neben ihm auf die Bank fallen lasse und nach seinem Tee
greife.
»Brahms war Pianist«, erklärt er und hält den Becher geschickt
außerhalb meiner Reichweite. Dabei achtet er sorgfältig
darauf, dass seine Violine nichts abbekommt. Er erzählt zwar
nicht viel, aber anscheinend läuft sein Studium am Königlichen
Musikkonservatorium richtig gut. Schon jetzt wurde er mehrfach
gelobt und sogar als Solist für ein Konzert im königlichen
Palast auserkoren, bei dem aufstrebende Musiker vor dem Hof
der Farben auftreten sollen. In zwei Wochen wird es so weit
sein. Ich könnte kaum stolzer auf ihn sein. Als er sich nach endloser
Bohrerei gestern Abend endlich dazu herabließ, es mir zu
erzählen, wusste ich plötzlich wieder, wie sich reine, ungetrübte
Freude anfühlt. Er hingegen musterte nur meine blauen Flecken
und Verbände und presste die Lippen zu einem dünnen, traurigen
Strich zusammen.
»Kein Grund, so ein finsteres Gesicht zu ziehen«, wiederhole
ich nun, was ich ihm schon am Vorabend gesagt habe. »Wir sind
endlich in Sicherheit.« Ganz bestimmt werde ich ihm nichts von
dem Angriff erzählen. Albträume sind etwas für die Nacht. Ich
möchte von jetzt an nur noch über angenehme Dinge sprechen.
»Hast du gut geschlafen?«
»Gequält von der unfassbaren Geschichte meiner kleinen
Schwester und ihrer Flucht aus England. Und du?«
»Getröstet von dem Wissen, dass ich sicher in Frankreich
angekommen bin. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich
sich die Dinge bewerten lassen.«
»Werd jetzt bloß nicht frech«, sagt er. »Ich habe ja wohl das
Recht, ein wenig besorgt zu sein, wenn ich erfahre, dass meine
Schwester innerhalb von nur drei Monaten vom Kronprinzen
von England verführt, ausgepeitscht und zum Tode verurteilt
wurde. Und dass sie es im Anschluss daran versäumt hat, seine
Erinnerungen zu löschen, bevor sie aus dem Land floh, weil sie
nun einmal der Meinung ist, man könne ihm trauen.«
Das schon wieder. »Haben wir das nicht schon gestern alles
durchgekaut?«
»Du hast es durchgekaut. Mir wurde dieser Brocken einfach
vor die Füße geworfen.«
»Wie ich bereits sagte«, erkläre ich ihm zum gefühlt hundertsten
Mal, »muss er selbst ein Geheimnis hüten. Eines, das
sogar folgenschwerer sein dürfte als meines. Er wird mich nicht
verraten.«
Und er hat gesagt, dass er mich liebt.
»Bis es ihm dann plötzlich doch in den Kram passt«, murmelt
Liam.
»Du kennst ihn doch gar nicht«, erwidere ich schärfer als
beabsichtigt. Warum verteidige ich den Prinzen eigentlich? Vielleicht,
weil ich ihn jetzt schon so sehr vermisse, dass es wehtut.
»Bitte verzeih, dass ich keinen Fanclub für den Mann gründe,
der dich hinrichten lassen wollte«, pflaumt Liam mich an. »Mir
liegt eben einiges an deiner fortwährenden Existenz.«
Einen Moment lang starren wir uns nur wütend an. Schon
immer konnten wir uns gegenseitig von einer Sekunde auf die
andere auf die Palme bringen. Dann berührt er meine Finger,
und die wundervolle Sinfonie seines Geistes strömt in mein
Bewusstsein. Sie ist nicht ganz so voll wie in meiner Erinnerung,
klingt jetzt eher fokussiert. Aber dadurch ist sie nicht weniger
einladend, nicht weniger liebevoll. Wenn überhaupt, hat sie an
Wildheit gewonnen. Ein bisschen wie Ninons Geist.
»Verzeih mir«, sagt er leise. »Ich kann einfach noch nicht
glauben, dass all das real ist. Dass du in Sicherheit bist.« Wenn
dir etwas zugestoßen wäre, hätte ich ihren Palast dem Erdboden
gleichgemacht, ihn bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das
hätte ich sowieso tun sollen.
Ich drücke seine Hand. Als ob es da etwas zu verzeihen gäbe.
Liam erwidert den Druck, bevor er meine Hand loslässt. »Und
eine leibhaftige Feuerschwester«, scherzt er. »Muss ich dir jetzt
huldigen? Wären zwei Opfergaben pro Tag ausreichend?«
Sofort bringe ich ihn zum Schweigen. »So etwas wie Feuerschwestern
gibt es nicht. Das ist bloß eine Legende.«
»Nein, nein, ist schon gut. Ich wusste immer, dass du etwas
Besonderes bist.«
»An mir ist überhaupt nichts Besonderes«, betone ich. »Wenn
überhaupt, bist du hier die große Nummer, immerhin darfst du
schon nach ein paar Monaten Studium bei Hofe auftreten.«
»Eine große Nummer vielleicht, aber trotzdem total pleite«,
erwidert er leichthin und überlässt mir endlich den Teebecher.
»Weißt du, was ich für diesen einen Tee bezahlt habe? Das ist
eine echte Unverschämtheit. Und ich habe auch keine Zeit
mehr für Straßenmusik. Mal ganz abgesehen davon, dass hier
die Konkurrenz viel größer ist.« Er deutet zur anderen Straßenseite
hinüber, wo eine hochgewachsene Frau Saxofon spielt.
Blues. Ein toller Rhythmus, da will man gleich mitwippen.
»Mach dir darüber mal keinen Kopf«, lache ich. »Du spielst
bald für den Roi.«
So nennen sie hier ihren König: Roi. Noch kann ich das Wort
nicht richtig aussprechen, aber ich arbeite daran. Liam spreizt
die Finger. »Bedauerlicherweise
zahlt der nicht sonderlich gut.«
Erst jetzt bemerke ich, dass sein Hals leicht gerötet ist, ein klares
Zeichen von Nervosität. Wie entzückend – mein großer Bruder
ist nervös.
»Trotzdem ist das eine ziemlich große Sache«, trieze ich ihn.
»Die Presse wird da sein. Fernsehen, Radio, Talentsucher.«
»Oh Mann, halt bloß die Klappe.« Jetzt ist sein Hals glühend
rot. Ich muss lachen. Er ebenfalls, schlägt dann aber die Hände
vors Gesicht. »Die Besten der Besten haben vor ihm gespielt. Da
kann ich mich nur blamieren. Sie werden mich bemitleiden.«
»Ich gebe zu, es ist wirklich schwierig, eine solche Riesenenttäuschung
zum Bruder zu haben, aber ich werde schon irgendwie
damit klarkommen«, versichere ich ihm großmütig. Das
bringt mir einen Boxhieb gegen den Arm ein.
Ich zucke zusammen – etwas zu heftig. Liam mustert mich
prüfend. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Klar doch. Alte Verletzung«, lüge ich. Das kann ich verdammt
gut, auch wenn ich mir wünschte, es wäre anders.
»Ach so. Tut mir leid.«
»Ist schon gut.« Schnell wechsele ich das Thema: »Verrate
mir lieber, was du spielen wirst und wie ich auf die Gästeliste
komme.«
Verlegen spielt er an einer seiner manchettes herum. Sie ist
leuchtend grün. Inzwischen hat er sich offenbar ziemlich an
die Bänder gewöhnt. Er trägt sie um seine enge schwarze Jeans
gewickelt, über den langen Ärmeln und am Hals, immer Rot
und Grün. Ich habe sogar schon einen Hauch grünen Glitzer
auf seinen Lidern gesehen. Das passt gut zu seinen Augen.
Deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Saxofonistin auf der
anderen Straßenseite ihm zwischen den Songs immer wieder
Blicke zuwirft.
»Als sie mich gefragt haben, ob sie jemanden für mich auf
die Gästeliste setzen sollen, wusste ich noch nicht, dass du zum
Konzert hier sein würdest, also habe ich Nein gesagt.«
»Du bist vermutlich der schlechteste Bruder aller Zeiten.«
»Oh bitte«, spottet er. »Du brauchst mich doch gar nicht, um
Zugang zum Hof der Farben zu bekommen. Frag einfach deine
berühmte neue Freundin.«
So nennt er Ninon immer. Meine berühmte neue Freundin.
Womit er natürlich nicht unrecht hat. Sie ist die Duchesse
d’Orléans, Schwester des Königs von Frankreich und CEO von
M3RL1N, einem der größten Konzerne des ganzen Kontinents.
Und sieht noch dazu absolut umwerfend aus. Natürlich.
»Seit sie in den Palast gezogen ist, habe ich sie nicht mehr
gesehen«, erkläre ich ihm bemüht sorglos, schaffe es aber doch
nicht ganz, meine Anspannung zu verbergen. Gerade mal zwölf
Stunden nach unserer Ankunft in Paris – ich war noch kaum bei
Bewusstsein – klopfte es plötzlich an Renés Tür: ein Gesandter
des Roi. Der wollte, dass seine Schwester bei Hofe gepflegt wird.
Ninon versuchte zu protestieren, aber da ihr Zustand genauso
miserabel war wie meiner, schien das niemand zu bemerken.
René war da schon wesentlich nachdrücklicher,
wurde aber vom
Comte mit einem Blick zum Schweigen gebracht. Selbstverständlich
wurde den Wünschen Seiner Majestät Folge geleistet. Blanc
verkniff sich während des ganzen Prozesses jeden Kommentar,
auch wenn er meine Hand so fest umklammert hielt, dass ich
mehrere Knochenbrüche befürchtete.
Hinterher hörte ich sie streiten, René und den Comte, als sie
dachten, Blanc und ich wären eingeschlafen. Was sie sich gegenseitig
an den Kopf warfen, verstand ich nicht, aber René wurde
immer wieder laut, während der Comte fast schon unnatürlich
ruhig blieb.
»Sie wird bestimmt gut versorgt«, sagt Liam nun. Ich nicke.
Natürlich, schließlich ist sie die Schwester des Roi. Sie wird sich
vor Maltoren und Ärzten kaum retten können. Aber sie fehlt
mir. »Allerdings hat sie nicht einmal eine Telefonnummer hinterlassen.
Wie soll ich es da noch auf die Gästeliste schaffen?«,
scherze ich.
»Die Mousquetaires werden eine Wache abstellen. Vielleicht
können die dich reinschmuggeln.«
»Nein, ich habe ihre Großzügigkeit schon mehr als genug
strapaziert«, sage ich mit Nachdruck. Dass sie sich um Blanc
und Ninon kümmern, ist verständlich, immerhin sind sie alte
Freunde und Waffenbrüder. Dass sie mir dieselbe Freundlichkeit
erweisen, ist geradezu unglaublich. Während ich noch halb
im Delirium war, haben sie sich sogar eine Erklärung für Blancs
und meine überstürzte Abreise aus London ausgedacht: Ihr
Capitaine schrieb dem Weißen König eine Nachricht, in der er
ihm erklärte, der Roi habe Blanc bei der Rückkehr der Duchesse
wieder nach Paris abkommandiert, um für ihren Schutz zu sorgen,
während die Duchesse darum gebeten habe, dass ich sie
begleite, als ihre besondere Freundin.
»Ich bin jedenfalls froh, dass du bei mir einziehst«, stellt Liam
fest. »So kann ich immer ein Auge auf dich haben.«
Jetzt würde ich ihn gerne boxen, halte mich aber zurück,
da meine Finger das vielleicht nicht so gut verkraften würden.
»Wird dir bestimmt guttun, eine Weile auf dem Boden
zu schlafen«, schieße ich stattdessen zurück. So oder so bin ich
froh, momentan nicht in London zu sein. Es war dumm, Winter
für den Anschlag auf den König verantwortlich zu machen.
Dadurch sind die Repressalien nur noch weiter verschärft worden.
Aber die Königin ließ uns keine andere Wahl.
Liam lacht laut auf. »Manja meinte, sie hätte eine alte Matratze
für dich gefunden, bis wir uns etwas Richtiges leisten können.«
Ich muss ebenfalls lachen. In Wahrheit können wir uns mo-
mentan nicht mal etwas Un-Richtiges leisten. Wenn wir über die
Runden kommen wollen, werde ich mir bald eine Arbeit suchen
müssen. Aber wir hatten nie viel Geld, und in diesem Moment
ist mir das auch völlig egal: Ich sitze in der Sonne, habe meinen
Bruder neben mir und einen heißen Tee in der Hand. »Mag sein,
aber ich glaube, Beethoven hätte lieber mich als Bettgenossin.«
Beethoven ist die Katze, die nie wieder gegangen ist, seit Liam
sie einmal gefüttert hat. Sie schlüpft regelmäßig am frühen Morgen
durch die Dachluke und rollt sich am Fußende des Bettes
zusammen – unabhängig davon, wie nass oder schmutzig sie ist.
»Dumme Katze«, brummt Liam und streckt sich. »Immerhin
bringe ich das Futter nach Hause.« Da sein Stipendiumsgeld
fast komplett für die Miete der winzigen Dachkammer
draufgeht, arbeitet er abends zusätzlich in der Cafeteria des
Konservatoriums. Vielleicht könnte ich mir etwas Ähnliches
suchen. Wenn ich doch nur schon Französisch könnte – was
nicht der Fall ist. Und Qualifikationen habe ich auch keine. Es
sei denn, jemand braucht einen Undercover-Bodyguard. Darin
habe ich Erfahrung. Vor allem aber habe ich Erfahrung darin,
mich in meinen Schutzbefohlenen zu verlieben. Gott, wie ich
es hasse, dass meine Gedanken ständig um Robin kreisen. Um
seine tiefe Stimme, seine Schlagfertigkeit, seine blauen Augen,
in denen oft kalter Zorn lodert. Wie er aus Hamlet zitiert und
mich zu einer illegalen Theateraufführung mitgenommen hat,
wo wir dann zusammen in einer der Garderoben gelandet sind.
Mühsam versuche ich, den Blick auf Paris zu richten. Liam sitzt
schweigend neben mir. Wir beobachten die Touristen, die voller
Begeisterung die Kathedrale bestaunen, sich über den Sonnenschein
freuen, das blanke Holz unserer Bank und die frisch
gedruckten Bücher im Schaufenster bewundern. Ich höre Englisch,
Französisch, Polnisch, Deutsch. Die Katze aus dem Buchladen
kommt angeschlichen
und beschnüffelt neugierig unsere
Finger. Nachdem sie eine Weile überlegt hat, gestattet sie uns,
sie zu streicheln. Ich vergrabe die Finger in ihrem Fell, bis ich
ihre Haut berühre. Ihr Bewusstsein gleicht einem Feuerwerk.
Es ist so ganz anders als das eines Menschen. Ein umwerfendes
Erlebnis. Angeblich fürchten sich viele Magdalenen davor, weil
es sie so desorientiert zurücklässt, dass ihnen übel wird, sie das
Bewusstsein verlieren oder sogar Fieber bekommen. Auf mich
trifft nichts davon zu. Ich betrachte die Welt gerne durch den
Filter eines fremden Geistes. Die Katze beginnt zu schnurren,
und Liam gibt Laute von sich, die dem sehr ähnlich sind. »Was
haben wir doch für ein Glück«, sagt er.
Wo er recht hat, hat er recht. Einige Mousquetaires schlendern
an uns vorbei, ohne uns die geringste Beachtung zu schenken.
Schließlich sind wir einfach nur zwei junge Menschen, die
vor einem Buchladen sitzen und Tee trinken.
Sobald Liam ausgetrunken hat, machen wir uns auf den
Weg – weg vom Fluss und der Île-de-Corail mit ihren teuren
Restaurants, Regierungsbehörden und dem Hauptquartier der
Mousquetaires, direkt gegenüber der Kathedrale. Stattdessen
gehen wir ins Quartier Latin, heutzutage Corail genannt. Liam
erklärt mir die Stadt und wie man hier lebt. Er zeigt mir seine
Lieblingsbäckerei in der Rue Monge, den Markt, auf dem er
seine Lebensmittel einkauft, den Supermarkt, aus dem Beethovens
Futter stammt. Dabei kommen wir an zwei Theatern, fünf
Buchhandlungen, einem Dutzend Cafés und Bars, drei Diskotheken
und zwei Seidenhändlern vorbei. Und an unzähligen
Menschen, deren Kleidung auf der anderen Seite des Kanals
nicht einmal als solche angesehen würde. Als Verbrechen gelten
würde. Unverhüllte Hälse, Arme, Beine, Gesichter. Es ist wie im
Traum. Ja, das muss ein Traum sein. Wie hätte ein solcher Ort
denn all die Jahre existieren können, während ich in London
und Amerika Kragen trug, die bis zu den Augenwinkeln reich-
ten, um mein Gesicht vor unbeabsichtigter Berührung zu schützen.
Handschuhe trug, die an den Ärmeln festgenäht waren.
Wäre ich an einem Ort wie diesem geboren worden, hätte
ich dann sorglos und in Sicherheit aufwachsen können? Der
Gedanke ist vollkommen verrückt.
Hier bieten Magdalenen ihre Dienste ganz offen an. Liam
zeigt mir einen Laden, den ich geschlagene zehn Minuten lang
fassungslos anstarre, weil ich es einfach nicht glauben kann. Er
heißt Gesunder Geist und scheint eine Kooperation eines Mensators
mit einem Maltoren und einem Memextraktor zu sein, die in
die Gedanken, Gefühle oder Erinnerungen ihrer Kunden eintauchen,
um ihnen bei Stressbewältigung, Migräne oder geistigen
Beschwerden zu helfen. Sie haben einen offiziellen Abschluss.
Einen Titel. Und sie präsentieren am Türpfosten stolz ihre Seidenbänder:
blau für den Mensator, grün für den Maltoren, Gelb
für den Memex. Einfach nicht zu fassen. Ich lege eine Hand an
das Schaufenster. Was könnte ich hier nicht alles werden.
Während wir weitergehen, fällt mir auf, wie problemlos ich
in der Menge aufgehe. Niemand beachtet mich. Wir spazieren
an der Straße vorbei, die zur Moschee und zu Liams Wohnung
führt, und halten auf die Place Contrescarpe zu, wo wir uns mit
ein paar von Liams Kommilitonen treffen. Sie kommen aus den
verschiedensten Ländern. Liam stellt mir einen nach dem anderen
vor. Seine Freundin Manja ist die Erste. Lächelnd beugt sie
sich zu mir. Ich kann nicht glauben, dass sie das wirklich tut. Sie
begrüßt mich auf die gleiche Art, die ich auch schon bei anderen
beobachtet habe, indem sie ihr Gesicht an meines drückt
und mir einen Kuss auf jede Wange haucht.
Sie tut es tatsächlich. Sie alle tun es, sie alle lassen mich in
ihren Geist. Ohne Angst. Ohne zu zögern. Für sie ist das so normal
wie ein Devotionsknicks. Und zur Begrüßung sagen sie alle,
wie es hier üblich ist: »Mögest du stets offenen Geistes sein.«
Ich bin im Himmel.
Zumindest bis einer von Liams Kommilitonen, der Junge mit
der Flöte, bei meinem Anblick die Augen aufreißt. »Moment
mal«, sagt er. »Bist du nicht das Mädchen, das mit dem Kronprinzen
von England zusammen ist?«
Alle sehen mich an. Mir fällt wieder ein, welche Lügen der
Weiße Hof der Presse untergeschoben hat … wir der Presse
untergeschoben haben. Demnach war ich nicht der Bodyguard
des Prinzen, sondern hatte »sein Interesse geweckt«. Entsprechend
hofierte er mich. Was wir ihnen auch vorgespielt haben,
erst auf einer Pressekonferenz, dann bei einem Abendessen im
Savoy. Irgendwann war es keine Schauspielerei mehr, sondern
wurde real.
Ich sollte die Bemerkung mit einem Achselzucken abtun können.
Ich bin schließlich eine gute Schauspielerin, ich liebe es, in
fremde Rollen zu schlüpfen. Es hat nicht funktioniert. Ein ganz
einfacher Satz. Nur ein paar Worte, vollkommen unverkrampft
vorgebracht, vielleicht mit einem kleinen Lachen garniert. Aber
ich schaffe es nicht.
»Ehrlich, Cos«, rettet mich Manja, »du bist eine solche
Tratschtante.«
Cos hat zumindest den Anstand, rot zu werden. »Er ist eben
heiß, okay? Da lohnt es sich, auf dem Laufenden zu bleiben.«
»Du könntest ja versuchen, Monsieur le Roi bei unserem Konzert
im Palast mit deiner meisterhaften Darbietung zu becircen«,
schlug Manja trocken vor. Irgendwie erinnert sie mich an Zadie,
mit der ich in der Schneiderwerkstatt in London zusammengearbeitet
habe. Hoffentlich geht es ihr gut. Cos rümpft empört
die Nase. »Das überlasse ich wohl eher Mister Erstes-Solo-nachdrei-
Monaten.« Er zeigt auf Liam.
»In dieser Suite gibt es sowieso kein Flötensolo, das deinem
Talent gerecht würde«, stichelt Liam, während ein anderes Mäd-
chen sich empört: »Hast du dir den Roi überhaupt mal angesehen?«
»Er sieht doch nicht schlecht aus.«
»Nicht schlecht? Mit diesem Schnurrbart?«
Ich atme erleichtert auf, als sie begeistert weiterzanken.
Schließlich mache ich sogar mit. Es ist ganz leicht. Verstohlen
beobachte ich Liam, der gerade fröhlich lacht. Selten habe ich
etwas Schöneres gesehen. Wir könnten hier glücklich werden.
Irgendwann setzen wir uns in ein Café weiter unten in der
Rue Monge, um uns aufzuwärmen. Hinten im Raum spielt
ein Pianist, und die Musik untermalt unsere Gespräche. Liams
Freunde trinken fast alle Kaffee aus winzigen Tassen. Espresso,
vermute ich. Ich probiere einen. Er schmeckt bitter, sehr intensiv.
Irgendjemand empfiehlt mir lachend, als Nächstes einen
Café au lait zu probieren, allerdings nur, wenn ich ein volles
Bankkonto hätte. Cos erklärt mir, wo ich am besten auf Jobsuche
gehen soll. Er winkt sogar den Kellner herbei, um zu fragen,
ob hier vielleicht jemand gebraucht würde – auf Französisch
natürlich. Während ich ihm zuhöre, frage ich mich bedauernd,
warum er nicht singt. Seine Stimme ist so weich und voll. »Er
wäre bestimmt ein großartiger Sänger«, raune ich Manja zu,
während Cos mit dem Kellner plaudert.
Die verdreht nur die Augen. »Sag ihm das bloß nicht. Sein
Ego ist auch so schon groß genug.«
»Bist du jetzt nicht etwas zu hart zu ihm?«, frage ich scherzhaft.
Bevor Manja antworten kann, schreit Cos begeistert auf.
Zusammen mit dem Kellner deutet er auf die Straße hinaus, wo
sich gerade ein schwarzer Wagen nähert. »Das ist eine Limousine
aus dem königlichen
Fuhrpark«, erklärt Cos aufgeregt und
steht auf, um besser sehen zu können. Ich lehne mich in meinem
Stuhl zurück und schließe die Augen, sauge die Wärme
des Heizpilzes in mich auf. Was für ein Leben. Ich kann ganz
entspannt hier sitzen und zusehen, wie eine schwarze Limousine
vorbeifährt, ohne gleich um mein Leben fürchten zu müssen.
Denn was auch immer die Königliche
Garde hierherführt, es
hat sicher nichts mit mir zu tun. Ich kann einfach weiter meinen
heißen Kaffee trinken, den Kopf auf Liams Schulter legen
und der gedämpften Sinfonie seines Geistes lauschen, die sich
trotz der Kleidung, die uns trennt, erahnen lässt.
Plötzlich höre ich ein Räuspern. »Mademoiselle?«
Es ist der Oberkellner. Er mustert mich erwartungsvoll. Ich
richte mich auf. »Ja?«
»Sind Sie so weit?«
Verwirrt starre ich ihn an. Darf ich hier arbeiten? Sehe ich
überhaupt angemessen aus? »Jetzt gleich?«
»Aber ja. Davon gehe ich aus.«
»Gibt es keine … Formalitäten zu erledigen?«
»Nein.«
»Aber sollte ich dafür denn nicht besser Französisch können?«
Ich werde immer verwirrter.
Das scheint den Kellner irgendwie zu kränken. »Mademoiselle
«, setzt er an und reckt steif das Kinn. »Der Roi Citoyen
spricht ausgezeichnet Englisch.«
»Rea«, sagt Liam drängend, und da begreife ich endlich.
Die Limousine hat direkt vor dem Café angehalten. Vor unserem
Tisch steht ein Mousquetaire in schwarz-blauer Uniform.
Und er sieht mich unverwandt an. »Entschuldigung, Mademoiselle,
ich wusste nicht, dass Sie kein Französisch sprechen. Man
hat mich gebeten, Sie abzuholen.«
»Wer hat Sie darum gebeten?«, frage ich, obwohl die Antwort
schmerzlich klar auf der Hand liegt.
»Seine Majestät, der König von Frankreich.«
Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein.
Ich weiß, dass ich eigentlich nicht nervös sein sollte, als ich
in der schwarzen Stretchlimousine Platz nehme, aber bei Maria
noch mal, das kommt mir alles so verdammt vertraut vor. Nur,
dass ich diesmal nichts zu befürchten habe. Ich habe nichts getan.
Außer Seine Majestät den König von England anzugreifen
und seinen Geist zu manipulieren, natürlich.
Der Mousquetaire starrt mich unverblümt an. Er ist sehr
aufwendig gekleidet. Diese Jacke, der Hut und dieses Cape
sind wohl eher für zeremonielle Anlässe gedacht, nicht für den
Kampf. Er muss so um die fünfzig sein, zumindest sind Bart
und Haare schon stark ergraut. Ich wüsste nicht, wann ich in
England je so offen gemustert worden wäre. Zumindest nicht
vor meinem Eintreffen am Weißen Hof. Im gläsernen Turm des
Weißen Königs, dem nichts verborgen bleibt.
»Sie sind Miss Rea Emris«, stellt mein Gegenüber schließlich
fest. Er spricht fließend Englisch, was mich leicht beschämt.
»Offenbar sind Sie mir gegenüber im Vorteil«, erwidere ich
leicht trotzig.
»Nicht nur in dieser Hinsicht.« Seine Antwort könnte als
Scherz gemeint sein. Oder eine Drohung beinhalten. »Ich bin
der Capitaine der Mousquetaires.«
»Und da dienen Sie dem König als Laufbursche?« Sobald ich
die Worte ausgesprochen habe, wünschte ich, ich hätte es nicht …
Entdecke jetzt, wie es im zweiten Teil weiter geht!
Jetzt bestellen
Lasst London brennen.
Die Straßen stehen in Flammen. Dass eine Stadt so brennen
kann, eine Stadt aus Glas und Stein.
Dass Glas so brennen kann. Es schmilzt vor meinen Augen.
Dieser grauenhafte, brüchige Ort.
Lasst London brennen.
Ich höre Schreie.
Lasst sie alle brennen.
*
Kämpfe enden nie mit einem Schrei. Sie enden mit einem Wimmern.
Meine Gegnerin presst den Arm gegen meine Kehle,
drückt mich hinunter. Sie ist klein und schmal, aber ihre Hände
sind ebenso nackt wie meine. Um ihren Oberkörper ist ein violettes
Seidenband gewickelt. Aus der Nähe kann ich die goldenen
Flecken in ihren braunen Augen sehen. Ihre Nase ist wie gemeißelt,
Locken hängen ihr ins Gesicht. Und in meines. Weich wie
in der Werbung.
Sie zerquetscht mir die Kehle, und ich muss würgen.
Warum konnte ich es nicht sein lassen?
Weil diese Arena einfach fantastisch ist. Natürlich sind Kämpfe
dieser Art hier ebenso illegal wie dort, wo ich herkomme, aber
das scheint niemanden zu interessieren. Mein Gehirn registriert
den Sauerstoffmangel, und plötzlich fühle ich mich ganz leicht.
Der dichte Zigarettenqualm, die glitzernden Kleider, Anzüge und
Hüte des Publikums, der Geruch von Champagner … Es kommt
mir so vor, als würde ich schweben. Fliegen. Absolut berauschend.
Und natürlich ihr Geist. Mit meinem Bewusstsein in ihn einzutauchen
lässt mich noch höher fliegen. Er besteht aus bunten
Glasperlen, die wie funkelnde Sterne vom Himmel fallen,
auf glänzenden Steinfliesen landen. Sie rollen durch meinen
Geist, sodass ich auf ihnen ausrutsche. Es ist eine Falle. Sie ist
ein Schnüffler, und Fallen sind deren Spezialität. Immer wenn
ich glaube, sicheren Boden unter den Füßen zu haben, trete ich
auf eine neue Lage grüner Perlen, die unbemerkt herangerollt
sind. Sie wogen hin und her wie das Meer, wie ein großes wildes
Lebewesen. Sie lassen mir keine Chance zur Flucht, lassen mich
nicht gehen. Mir schwirrt der Kopf. Die Welt vor meinen Augen
verdunkelt sich. Ich höre nur noch mein eigenes Wimmern,
mein verzweifeltes Ringen um Luft. Und das leise Klicken der
Glasperlen, klick, klick, klick …
Und dann: Applaus.
Sie lässt mich los. Hustend und würgend setze ich mich auf.
Meine Brust krampft, meine Lunge zieht sich zusammen, dehnt
sich wieder aus. Sauerstoff schießt in meine Adern. Eine heftige
Bruchlandung beendet meinen Höhenrausch – ohne abzubremsen,
ohne sanften Sinkflug. Es ist eher so, als würde Blanc
mir einen Schlag ins Gesicht verpassen. Und mir dann in den
Bauch treten. Während ich bereits am Boden liege. Ich spüre
den dunklen Teppich des Rings unter mir, sämtliche
Nerven schicken Schmerzsignale durch meinen Körper. Ich spüre die
Prellungen in meinem Geist. Die Kratzwunden. Mein rechter
Ellbogen wird nicht gebrochen sein, aber es fühlt sich so an. Als
bohrten sich die gesplitterten Knochen von innen in das Fleisch
meines Oberarmes. Und mir platzt gleich der Schädel.
Das war es wert.
Ich bekomme nur ganz am Rande mit, dass der Ringsprecher
meine Gegnerin zum Sieger erklärt. Das Publikum skandiert
ihren Namen. Silberpfeil nennt sie sich. Als sie mir auf die Beine
hilft, trägt sie bereits wieder Handschuhe. Der Schiedsrichter
reicht mir mein Paar. Silberpfeil lächelt, und ich erwidere es
gerne, als wir uns die Hände reichen – trotz der Schmerzen. Das
Adrenalin rauscht noch durch meine Adern. Mein Geist dehnt
sich genüsslich. Auch wenn ich verloren habe: Ihr Geist war die
reinste Wonne. Hätte ich gewusst, dass es so etwas gibt, wäre ich
schon viel früher nach Berlin gekommen.
Kampfarenen für Magdalenen.
Hier spielt es keine Rolle, wie man aussieht. Muskelmasse,
Größe, Gewicht, alles unwichtig. Hier zählt nur dein Geist.
Die Menge bejubelt uns. Langsam bekommen die verwaschenen
Konturen wieder Schärfe. Das Publikum sitzt an kleinen
Tischen, die rings um den Ring aufgestellt sind. Man raucht
Zigaretten im Halter, trägt Perlen und Federn. Direkt vor mir
ist eine Frau in Schwarz gerade dabei, in aller Ruhe die obersten
drei Hemdknöpfe ihres Begleiters zu öffnen. Sie legt ihm eine
Hand auf die nackte Brust. Ihr Gesicht ist weiß geschminkt,
seines ebenfalls. Augen und Lippen sind blau. Er trägt einen
schwarzen Hut und ein leuchtend blaues Einstecktuch. Gelassen
schiebt er ihr einen Träger ihres Kleides von der Schulter.
Dann küsst er ihren Hals. Ganz langsam legt sie den Kopf in den
Nacken. Die beiden beobachten mich, auch jetzt noch. Ihr Tisch
war der einzige, an dem auf mich gesetzt wurde.
Silberpfeil und ich bedanken uns für den Kampf, dann taumele
ich aus dem Ring. Der Schweißgeruch lässt nach, wird verdrängt
von Zigarettenrauch und einem Potpourri aus scharfem
Rasierwasser und feinen Parfüms. Hier drin gibt es neben dem
Parkett noch zwei Ränge: Auf dem ersten trägt man statt Weste
Jackett, auf dem zweiten komplette Dreiteiler. Die Band setzt
wieder ein, Klavier, Saxofon und Schlagzeug vereinen sich zu
wilden Jazzklängen. Schaumwein fließt, Feuerzeuge zischen, der
schwere Duft von gebratener Ente zieht vorbei. Ich nicke dem
Pärchen am Tisch zu, als ich an ihnen vorbeigehe. Sie streckt die
Hand aus, stützt mich. Erst da wird mir klar, dass ich torkele.
»Schön langsam«, sagt sie mit leichtem Akzent. Ihr Begleiter
hat die Füße auf den letzten freien Stuhl am Tisch gelegt. »Das
schien nicht gerade vergnüglich zu sein.«
Ich mustere die Frau. Im ersten Moment nehme ich nur ihre
schimmernden Perlen wahr. Wie die Glasperlen. In dem Aschenbecher
auf ihrem Tisch liegen drei Zigarettenstummel. Ich habe
gar nicht bemerkt, dass sie geraucht hätten. Allerdings war ich
auch ziemlich beschäftigt.
»Nein, es war großartig.«
Als ich an die Bar trete, hat mir die Barfrau bereits Champagner
eingeschenkt. »Kämpfer kriegen einen aufs Haus«, erklärt
sie mir. Ihre Haare sind ebenso dunkel wie ihre Haut. Mir gefällt
die Art, wie sie sich bewegt, so geschmeidig. Und routiniert. Sie
schenkt ein, mixt Cocktails. Bei einem sehe ich genauer hin:
Wermut, Gin, eine klare grüne Flüssigkeit, ein Blatt Minze.
Ganz zum Schluss lässt sie eine Perle hineinfallen. Offenbar ist
sie essbar. Ich bin wie gebannt.
»Was ist das für ein Drink?«, frage ich.
»Wir nennen ihn den Fascinator«, erklärt sie grinsend. »Ziemlich
wilder Kampf war das. Du lässt dich doch hoffentlich verarzten,
wenn du nach Hause kommst, oder?«
Dass sie mich ausgerechnet jetzt daran erinnern muss.
An Robin. Allein zurückgelassen in unserem Bett, während
ich mich rausgeschlichen habe wie eine heimliche Geliebte,
wie ein Dieb in der Nacht. Der Gedanke daran löst den nächsten
Adrenalinschub aus. Ein albernes Kichern steigt in mir auf. »Es
weiß niemand, dass ich hier bin.« Mein Champagnerglas ist
schon leer. Wann ist das denn passiert?
»Oh je. Lass mich raten: Rechtschaffener Freund?«
Ich muss schon wieder kichern. Die Barfrau grinst breit. Dann
mixt sie einen frischen Fascinator. »Also noch einen Drink aufs
Haus.«
Letzten Endes zahle ich auch für einen Drink – nein, zwei,
weil ich ihr ebenfalls einen Fascinator spendiere. Als ich mich
endlich losreiße, kann ich kaum noch geradeaus laufen. Irgendjemand
hilft mir die Treppe hinauf – es könnte Silberpfeil gewesen
sein, aber eigentlich auch jeder andere. Im Erdgeschoss sieht
alles so aus wie in einem ganz normalen Berliner Stadthaus: eine
lang gezogene Eingangshalle mit Mosaikfliesen, grüne Jugendstillampen
aus Glas an der Decke. Nichts Ungewöhnliches,
mal abgesehen von ein paar Champagnergläsern, die jemand auf
den Briefkästen abgestellt hat. Und der Spur aus glitzerndem
Konfetti, die sich von der Eingangstür bis zur Kellertreppe zieht.
Oder dem Geruch nach Wein, Zigaretten und teurem Parfüm.
Ziemlich eindeutige Hinweise, wenn ich so darüber nachdenke.
Draußen hat die Nacht offenbar vergessen, dass sie dunkel
sein sollte. Straßenlaternen brennen, Neonreklame blinkt,
Schaufenster und Cafés sind hell erleuchtet. Aus jedem offenen
Fenster, jeder offenen Tür dringt Musik auf die Straße. Hauptsächlich
Elektro-Swing oder Elektro-Jazz. Elektro eben.
Es hat aufgehört zu regnen. Der Duft von Frühling liegt in
der Luft, heiß ersehnt nach einem langen Winter. An der ersten
Straßenecke, die ich erreiche, steht ein Drehorgelspieler. Da wird
mir klar, dass ich in die falsche Richtung laufe, und ich drehe um.
In der anderen Richtung stoße ich an einer Kreuzung auf eine
Frau mit weißem Kopfhörer, die sich über ein Mischpult beugt.
Ihre Musik ist faszinierend, im einen Moment aufputschend, im
nächsten melancholisch. Ich schiebe mich durch die Menge der
Zuschauer vor ihrem Pult. Die Leute trinken, tanzen, schubsen
sich. Lachen und rauchen, sehen schweigend zu. Ich will bleiben,
will tanzen, aber ich war schon zu lange hier draußen.
Umgeben von Musik, Gelächter und grellen Lichtern gehe ich
zur U-Bahn. Leuchtende Schilder mit einem großen »U« darauf
kennzeichnen die Haltestellen. Diese hier heißt Ku’damm.
Hüpfend gehe ich die Treppe hinunter. Der Alkohol hat die
Schmerzen vertrieben. Jetzt könnte ich wieder fliegen. Wieder
in Silberpfeils faszinierenden Geist eintauchen, die klimpernden
Glasperlen spüren, Sterne, die vom Himmel fallen. Den Rausch
des Kampfes genießen, ohne mich verstecken zu müssen, ohne
um mein Leben zu fürchten, jeder Schlag ganz ich selbst. Den
Rausch von Schmerz, Adrenalin, Alkohol, Musik, dem Publikum,
dem Pärchen, das mich angefeuert hat. Ihre Hand auf seiner
Brust, seine Lippen an ihrem Ohr … meine Faust, die gegen
Silberpfeils Kiefer kracht. Ihr Geist. Ihre Lippen, so dicht an
meinen, als sie mir aufgeholfen hat.
Oh, Maria! Hoffentlich ist Robin nicht aufgewacht, während
ich weg war.
Als ich in der altmodischen, ratternden Bahn sitze, versuche ich
mich daran zu erinnern, wann ich am Morgen aufstehen muss.
Doch selbst als es mir wieder einfällt, tut das meinen Glücksgefühlen
keinen Abbruch. Morgen müssen wir uns mit dem Repräsentanten
des Weißen Hofes treffen – um unsere Rückkehr
nach London zu besprechen. Und in einer Woche werde ich
wieder dort sein. In einer Woche werde ich Berlin verlassen und
wieder Handschuhe tragen, Devotionsknickse machen und nicht
an das Fallbeil denken, das ständig über meinem Kopf schwebt.
In einer Woche bin ich wieder im Gläsernen Turm.
Ich lehne den Kopf ans Fenster und drücke die Finger an die
Scheibe. Dann sollte ich die Zeit besser nutzen.
Am Bahnhof Französische Straße steige ich aus. Hier ist es ruhiger,
ein respektables Viertel. Ich gehe die Friedrichstraße hinauf,
bis ich Unter den Linden ankomme, auf dem größten Boulevard
von Berlin. Groß und grau ragen die Bäume in den Nachthimmel
auf. Inzwischen ist es so spät, dass sogar die Beleuchtung
am Brandenburger Tor ausgeschaltet ist. Links davon befindet
sich unser Nobelhotel, das Altair. Ich gehe über den roten Teppich,
unter einem ebenfalls roten Baldachin hindurch und trete
ein. Die Hotelhalle erstrahlt in goldenem Licht. Hohe Decken,
Marmorboden, geschmackvolle Blumenarrangements an den
Wänden. Eine Galerie zieht sich um die gesamte Halle, in der
Lobby warten ausladende Sessel auf die Gäste. Normalerweise
sitzen dort immer Besucher und trinken nepalesischen Tee, blättern
in amerikanischen Zeitungen oder essen Gebäck aus Rom,
aber um diese Uhrzeit ist nur der Nachtportier zu sehen. Er zeigt
keinerlei Reaktion, als ich das Hotel betrete. Ein äußerst diskreter
Mensch.
Der Fahrstuhl klingelt leise, als er das oberste Stockwerk erreicht.
Die Königssuite. Ich schleiche hinein, ohne das Licht anzumachen.
Brauche ich auch nicht, denn von draußen fällt genug
Helligkeit ein: Unter mir breitet sich die gesamte Stadt aus
mit ihren funkelnden Wolkenkratzern, beleuchteten Häusern
und grellen Werbetafeln. Und das alles scheint durch die riesige
Fensterfront im Wohnzimmer. Ich schiebe mich an dem Flügel
vorbei, auf dem Robin vor dem Schlafengehen gespielt hat.
Na ja. Zumindest bevor er schlafen ging.
Ich habe jahrelange Erfahrung darin, mich irgendwo rein und
raus zu schleichen. Allerdings nicht, wenn ich so betrunken bin.
Betrunken und berauscht. Trotzdem schaffe ich es wohl, mich
einigermaßen leise zu waschen, meine Kleidung zu verstecken
und sämtliche sichtbaren Verletzungen zu versorgen. Als ich aus
dem Bad komme und mich auf die Matratze sinken lasse, rührt
sich Robin nicht einmal. Er atmet nur. Atmet leise und gleichmäßig
weiter.
Nachdem ich unter die Decke geschlüpft bin, drehe ich mich
zu ihm. Im Schlaf sieht er so friedlich aus. Selbst sein markantes
Kinn scheint weicher zu sein. Sein schlanker Körper ist von
der weißen Decke verhüllt, die sogar noch bleicher ist als seine
Haut. An einer Seite ist sie verrutscht, sodass ich das Muttermal
an seinem Brustkorb erkennen kann. Das habe ich in unserer
ersten Nacht hier in der Stadt entdeckt. Ein starker Kontrast zu
all der Blässe.
Am liebsten würde ich jetzt über seine Wange streichen, über
seinen Hals. Über die weiche Haut an seiner Hüfte.
Noch vor wenigen Stunden lag ich ebenfalls hier, spürte seine
Lippen an meinen. Ließ die Fingerspitzen über seine Rippen
gleiten. Holte Luft und ließ sie tiefer wandern. Ein wohliger
Schauer lief über seinen Körper.
Und dann haben wir es nicht getan. Wir sind nicht weitergegangen.
Das haben wir noch nie getan, nicht in London und
nicht in Paris, und ich weiß gar nicht, warum ich jedes Mal
zögere. Warum er zögert. Es fühlt sich an, als liefe uns die Zeit
davon, was mich unter Druck setzt. Mich jedes Mal erstarren
lässt, wenn ich die Decke ganz herunterziehen könnte. Sollte
es ganz spontan geschehen, wäre es in Ordnung, aber wenn ich
vorher darüber nachdenke, vermassele ich es einfach.
Außerdem … Was, wenn ich etwas falsch mache? Ich habe
keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet und auch nur eine vage
Vorstellung davon, wie es sein sollte: eine eheliche
Pflicht, die durchlitten wird, nichts Erfreuliches.
Und wenn es das wirklich nicht ist? Erfreulich, meine ich.
Heute Abend war ich sowieso zu rastlos. In meinem Kopf
drehte sich alles um London und den Weißen König. Um Erinnerungen
an die vergangenen Monate, an die unumkehrbaren
Veränderungen in meinem Leben. Ist es tatsächlich noch nicht
einmal ein halbes Jahr her, dass ich in London zum Undercover-
Bodyguard des Prinzen berufen wurde? Anfang Januar kam ich
das erste Mal an den Weißen Hof; im März bin ich nach Paris
geflohen. Jetzt haben wir Mai, und es sollte eigentlich bald Sommer
sein, allerdings wurden wir bisher fast nur mit Regen und
schweren, tief hängenden Wolken beglückt. Kein halbes Jahr ist
vergangen, seit ich Ninon und Blanc kennengelernt und mich
in Robin verliebt habe. Und trotzdem kommt es mir so vor, als
würde ich sie alle schon mein Leben lang kennen. Noch immer
überläuft es mich eiskalt, wenn ich an den Moment zurückdenke,
als ich herausfand, dass der König nicht Robins leiblicher
Vater ist und dass er deshalb Robins Tod wollte. Oder daran,
wie Ninon und ich dafür gesorgt haben, dass der König das
alles vergisst, was uns beide fast das Leben gekostet hätte. Als
ich anschließend mit ihr, Blanc, René, dem Comte und Liam
nach Paris ging, hoffte ich, endlich Frieden zu finden. Welch
eine Ironie, dass ich dort ausgerechnet von meiner eigenen
Mutter gejagt wurde. Die mich dann dazu brachte, nach London
zurückzukehren, um im Palast für sie zu spionieren – alles
unter dem Vorwand einer angeblichen Verlobung mit Robin.
Wer hätte gedacht, dass Robin einem solchen Wahnsinnsplan
zustimmen würde? Dass ich zustimmen würde?
Ja, vor wenigen Stunden lag ich hier und schlug mich mit
Gedanken an Robin, an Aufruhr, Rebellion und Magdalenen
herum. Dabei konnte ich hören, wie die Kreatur schnüffelnd
unter unserem Bett herumkroch. Irgendwann schlief ich ein und
hatte diesen furchtbaren Traum, in dem London in Flammen
stand, so heiß brannte, dass sogar das ganze Glas schmolz. Die
Schreie rissen mich aus dem Schlaf, Schreie von Menschen, die in
ihren gläsernen Häusern eingeschlossen waren. Danach warf ich
mich nur noch im Bett herum. Ich konnte einfach nicht bleiben.
Jetzt bin ich nicht mehr rastlos. Meine Angst ist verflogen.
Mein Geist erstrahlt in Glückseligkeit. Heute war ich das Kind
einer Nacht ohne Dunkelheit. Heute habe ich mich einem Kampf
ausgeliefert, der schmerzhaft sein sollte, es aber nicht war. Ich
habe Fremden ein Lächeln geschenkt, das sie mir zurückgaben,
habe mich von berührender Musik verzaubern lassen und wurde
von dieser Stadt willkommen geheißen, die so hell erstrahlt, so
brutal kämpft, den Rhythmus im Blut hat.
Diese Nacht gehörte allein mir. Ich weiß nicht, ob es überhaupt
jemals etwas gegeben hat, das so voll und ganz mir gehört
hat.
»Rea?«
Ich erstarre.
Robins Augen sind offen, wenn seine Lider auch schwer
erscheinen. Mit rauer Stimme fragt er: »Wie spät ist es?«
»Noch nicht Zeit aufzustehen«, antworte ich so leise wie möglich,
damit er das Zittern in meiner Stimme nicht hört.
»Gut.« Er tastet nach meiner Hand. Die Seidenstränge in
seinem Geist sind angespannt, fest um das Bild eines Mannes
geschlungen: den Repräsentanten des Weißen Hofes. Ich bin ihm
nie begegnet, aber Robin erinnert sich an ihn, den Count Vaisey
von Nottingham und Hannover. Da er gerade daran denkt,
kann ich Robins Erinnerung deutlich sehen: ein großer Mann
von beeindruckender Statur mit einem verschlagenen Lächeln.
So lächeln die Ritter der GVK, wenn sie den Befehl erteilen,
einem Hautstreicher die Handschuhe an der Haut festzunähen.
»Ist alles in Ordnung?«, fragt Robin, als er merkt, wie ich
erschauere.
»Ja«, sage ich. Er verschränkt unsere Finger miteinander, bevor
er wieder die Augen schließt. »Gut. Das ist gut.«
Unter dem Bett höre ich die Kreatur winseln. Sie existiert nur
in meinem Kopf, halte ich mir vor Augen. Ein Symptom des
Geistesfiebers, der Krankheit, gegen die ich tagtäglich ankämpfe.
Schon seit ich denken kann, leide ich darunter: Die Kreatur war
immer an meiner Seite, groß, grau, pelzig. Manchmal schnüffelt
sie nur an meinen Beinen, manchmal ist sie so stark, dass sie
schwer auf meine Brust drückt, bis ich mich nicht mehr rühren
kann. In Paris war ich deswegen bei einer Ärztin, die mir erklärte,
dass ich bisher Glück gehabt hätte, denn wenn Geistesfieber
nicht behandelt wird, kann es katastrophale Ausmaße annehmen.
Manche Patienten hat es in den Wahnsinn getrieben: Bei
ihnen wurde die Kreatur so groß und mächtig, dass sie irgendwann
nicht einmal mehr wussten, wer sie sind. Oder sie verfielen
in eine Art Blutrausch, bekamen rot glühende Augen und
endeten in einem Koma, aus dem sie nicht wieder aufwachten.
Niemals wieder. Magdalenen können durch die Krankheit sogar
ihre besonderen Fähigkeiten verlieren: Maltoren können nicht
länger Gefühle erkennen und Schmerzen nehmen oder geben,
wenn sie jemanden berühren; Memexe sind nicht mehr dazu in
der Lage, bei Hautkontakt in den Erinnerungen eines anderen
zu lesen; und Mensatoren wie ich verlieren die Fähigkeit, Gedanken
zu lesen und zu verändern. Sogar Schnüffler erkennen keine
anderen Magdalenen mehr. In Fällen des Blutrausches haben die
Patienten sowohl Angehörige als auch Fremde angefallen und
verstümmelt, jeden, der ihnen zu nahe kam. Eine beängstigende
Vorstellung.
Aber seit Paris nehme ich Medikamente dagegen, war bei
einem Therapeuten. Und es wird besser. Auch wenn ich glaube,
dass das nicht nur an den Medikamenten liegt, sondern ebenso
an Paris, an Berlin. Daran, dass ich endlich frei sein kann. In
diesen Städten fühlt es sich so an, als könnte die Kreatur mir
nichts anhaben.
Das wird sich in London ändern. Ich weiß, dass ich dort keine
Therapiesitzungen mehr bekommen werde, nicht einmal übers
Internet. Meine Ärztin in Paris hat mir davon abgeraten, zurückzugehen.
Aber ich kann es schaffen. Wie all die Jahre zuvor. Ich
kann nach London zurückkehren, dort für meine Freiheit kämpfen
und irgendwann diese grässliche Kreatur ganz loswerden.
Das wäre wirklich zu schön, um wahr zu sein.
Lasst London brennen.
Das Feuer ist so heiß. Weiß glühend wie Schneequarz.
»Feuerschwester!«, rufen sie.
Überall Feuerseide. Rot wie die Flammen.
Rot wie das Blut.
Lasst sie brennen.
Am nächsten Morgen fühlt es sich an, als wäre mein Kopf explodiert.
So habe ich noch nie gelitten. Eine eiserne Faust scheint
meinen Ellbogen zu zerquetschen. Und meine Oberschenkel.
Mein Sprunggelenk. Und mein Kopf … Oh, Maria! Was ist
mit meinem Kopf passiert? Warum bohrt der Ball aus Eis seine
pulsierenden Splitter in die Wände meines Geistes? Warum hat
sich das Feuer in meinen Hals ausgebreitet, in meine Adern, und
trocknet sie aus?
Aber am schlimmsten ist es, so tun zu müssen, als wäre alles
in bester Ordnung, während Robin mich mit einem Kuss auf
die Wange weckt. »Das ist wohl das erste Mal, dass ich vor dir
auf bin. Raus aus dem Bett, zwielichtige Fremde, bevor meine
Anstandsdamen dich hier finden!«
Ich presse einen nicht identifizierbaren Laut aus meiner
Kehle. Seine Finger gleiten herrlich kühl über meine Schläfen
und meine Stirn.
»Geht es dir wirklich gut, Rea?«
»Hab schlecht geschlafen«, murmele ich und schmiege mich
noch fester an seine Hand. Er beugt sich über mich und nimmt
mich einen Moment lang in den Arm. »Ich würde dich ja weiter-
schlafen lassen«, flüstert er mir ins Ohr, »aber wir müssen heute
beim Count of Nottingham Eindruck schinden. Er darf keinen
Verdacht schöpfen.«
Mein Mund wird noch trockener. Mühsam stehe ich auf und
ziehe an, was Robin mir gibt: ein weißes Kleid und einen Marienkragen,
beides aus Spitze, ebenso wie die Handschuhe. Sogar
eine alberne kleine Kappe gehört dazu und hohe Schnürstiefel.
Robin legt mir eine Perlenkette um den Hals. Spiritus apertus!
Ich schwöre mir, für den Rest des Tages in keinen Spiegel mehr
zu blicken. Und auch nicht darauf zu achten, dass die stählerne
Faust weitergewandert ist zu meinem Magen, wo sie für leichte
Übelkeit sorgt. Oder auch schwere.
Als wir in die Lobby hinunterkommen, steht unsere Entourage
schon bereit: vier Kaiserliche Wachen, geschickt von Kaiserin
Dana. Dann natürlich Mister Galahad, sogar noch korrekter gekleidet
als sonst mit einer Brokatjacke und einem Marienkragen,
wie er höher nicht sein könnte. Sein Gesicht ist weiß geschminkt.
Neben ihm wirkt René nur noch mehr wie ein Freigeist. Er
trägt Hemd und Hose, beides mit vielen bunten manchettes geschmückt.
Sein taillierter Mantel ist mit breiten Streifen in Grün,
Gelb, Blau und Violett verziert, die sich zu eleganten Mustern
verbinden. Sein Gehstock ist so grün wie die Nadelwälder an der
Ostküste der Vereinigten Staaten und in Kanada. Dazu bietet
der Hemdausschnitt nicht nur einen freien Blick auf Hals und
Schlüsselbeine, sondern lässt sogar den Ansatz seiner Brustmuskeln
erahnen. Er trägt Eyeliner und natürlich keine Handschuhe.
»Bonjour«, begrüßt er mich und ergreift meine Hand. »Oder
sollte ich besser Guten Morgen sagen?« Er haucht einen Kuss auf
meinen Handrücken. Als seine Lippen die feinen Löcher in meinen
Spitzenhandschuhen streifen, verkrampfe ich mich. Falls
noch geistige Wunden von letzter Nacht geblieben sind, wird er
sie bemerken.
Doch ihm scheint nichts aufzufallen, denn er lässt kommentarlos
meine Hand los und begrüßt mit einem Kopfnicken den
Prinzen. Sobald René aus dem Krankenhaus entlassen wurde,
zwang Capitaine Jean René dazu, Urlaub zu nehmen, weshalb er
spontan beschlossen hat, mit uns nach Berlin zu kommen. »Wer
könnte ein besserer Fremdenführer sein als ich, wenn es um
meine erste und einzig wahre Liebe Berlin geht?«, lautete sein
Argument. Während er sprach, hielt ich gerade seine Hand, und
so sah ich in seinen Gedanken seine Eltern vor mir und diese
Stadt, deren Straßen er besser kennt als die Pfade seines eigenen
Geistes. Und die er schon so lange nicht mehr besucht hatte.
Der Comte und Blanc haben versprochen, am Wochenende
zu uns zu stoßen. Liam ist bereits mit seinem Kater Beethoven
nach London weitergereist, um uns eine Wohnung zu suchen
und ein paar Kontakte von Madame Hiver aufleben zu lassen –
gegen meinen ausdrücklichen
Protest.
Kaum war Liam wieder auf der Insel, wurde er auch schon am
Weißen Hof vorgeladen. »An ein zukünftiges Familienmitglied«,
stand auf der Einladung, die von Ihrer Majestät der Königin unterzeichnet
war. Fast hätte er sie zerrissen. Aber nur fast.
Mister Galahad verbeugt sich vor uns. Er wirkt immer noch
ziemlich mitgenommen. Die Gedankenkontrolle durch meine
Mutter hat ihre Spuren in seinem Geist hinterlassen. Er sieht
uns nicht direkt an. »Guten Morgen, Miss Emris, Königliche
Hoheit. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nachtruhe?«
»Recht angenehm, ja«, antwortet der Prinz. Er hat sich ebenfalls
herausgeputzt, schwarzer Brokat mit silbernen Samtaufschlägen,
dazu das königliche Diadem. Und das alles für den Count of Nottingham.
»Ja, danke«, sage auch ich. Ohne mir ins Gesicht zu sehen,
führt Mister Galahad uns zum Frühstücksraum. Er geht dicht
neben Robin her. Lächelnd bietet René mir seinen freien Arm
an. Seine Beine zittern noch immer leicht, wenn er steht. Als ich
mich einhake, drückt er seine nackte Hand auf meinen durchlässigen
Handschuh.
»Obwohl du nicht sonderlich viel geschlafen hast, würde ich
wetten«, stellt er sachlich fest.
Eine Glasmurmel rollt durch meinen Geist. Klickend prallt
sie gegen den Eisball. Ich zucke zusammen. Dann verschwindet
sie. Fast so, als wäre sie von einer heilenden Hand entfernt worden.
Entgeistigte Maltoren.
René lacht nur, als ich diesen Gedanken laut ausspreche. »Um
ganz ehrlich zu sein – es waren die eindeutigen Anzeichen eines
Katers, die mich auf die richtige Spur gebracht haben. Warst du
in der Schnellen Faust oder in der Seidenhöhle?«
»In der Seidenhöhle. Woher kennst du diese Läden?«
»Oh, das sind einfach die Hot Spots, wenn man jung ist, in
Berlin lebt und seine ersten Schritte auf dem Gebiet der Geistesheilung
macht. Ich muss dich allerdings warnen.«
Ich seufze. Natürlich muss er das. »Es wird nicht wieder vorkommen.«
Mit leidgeprüfter Miene sieht er mich an. »Es verletzt mich,
dass du mir immer noch nicht ausreichend zu vertrauen scheinst,
da du eine so absurde Lüge für notwendig hältst.« Ich will protestieren,
während wir zwischen den Lobby-Sesseln hindurchgehen.
Mister Galahad und der Prinz sind uns ein ganzes Stück
voraus. René sorgt dafür, dass wir langsamer werden und der
Abstand sich noch vergrößert. »Ich wollte dich gar nicht davor
warnen, dort wieder hinzugehen. Ich wollte dich davor warnen,
nicht zurückzukommen.«
Das entlockt mir ein Schnauben. »Natürlich komme ich
zurück. Ich kann schließlich schlecht in der Seidenhöhle einziehen,
oder?«
»Das meine ich nicht.« Er senkt die Stimme. »Gewalt ist eine
Falle, Rea. Sie verschafft dir einen Höhenflug, durch den man
leicht die Bodenhaftung verliert. Glaub mir, ich weiß das.«
Plötzlich fällt mir wieder ein, was der Comte einmal gesagt
hat. Wenn es eines gibt, was man einem Heiler nicht begreiflich
machen kann, dann ist es das Bedürfnis nach Schmerz.
»Außerdem kann ich mir kaum vorstellen, dass Seine Königliche
Hoheit sonderlich begeistert davon ist«, fügt René hinzu.
Wie gut, dass er damit die Stimmung wieder etwas auflockert.
»Deshalb soll es ja auch ein Geheimnis bleiben.«
Nun bleibt René ganz stehen. »Rea. Wie soll er dich je richtig
kennenlernen, wenn du ihn belügst?«
Prüfend sehe ich ihn an. Weiß er es? Weiß er, dass der Comte
und Blanc sich draußen im Hof gegenseitig verprügeln, wenn
sie es nicht mehr aushalten, so zu tun, als wären sie unversehrt?
Nicht einmal um seinetwillen?
»Wie könnte er mich lieben, wenn ich es nicht tue?«
René macht Anstalten, etwas darauf zu sagen, aber da ruft der
Prinz nach mir.
»Rea? Kommt ihr?«
Er steht an der Tür zum Frühstücksraum, die Mister Galahad
bereits für ihn aufhält.
Drinnen sind noch mehr Kaiserliche Wachen an den Wänden
aufgereiht. Das überrascht mich nicht. Immerhin müssen sie
nicht nur den Kronprinzen von England und Wales beschützen,
sondern auch seine Geschwister, Prinz William und Prinzessin
Victoria. Die Zwillinge sitzen bereits an einem runden Tisch im
hinteren Teil des Saals. Als wir eintreten, steht Victoria auf und
winkt uns zu. Mit wild wedelnden Armen zieht sie Robin an
sich. Dabei ist sie um einiges kleiner als er, nur ungefähr so groß
wie ich. In jeder anderen Hinsicht ist sie allerdings das komplette
Gegenteil von mir: Sie hat die Augen ihres Vaters, und ihre
Haare wurden so stark gebleicht, dass sie bläulich schimmern.
Schockiert muss ich feststellen, dass sie Nagellack trägt.
»Herzlichen Glückwunsch«, begrüßt sie ihren Bruder. »Du
hast es eine ganze Nacht lang geschafft, weder umgebracht noch
entführt zu werden. Ich führe da genau Buch drüber, weißt du?«
»Guten Morgen, Nerverl«, murmelt Robin peinlich berührt.
Er hat mir bereits erzählt, dass William und er die Schwester
Nerverl nennen, weil … nun ja. Manchmal kann sie einem
wohl ein wenig auf die Nerven gehen. Mister Galahad räuspert
sich, aber sie lässt einfach nicht los. Seufzend erwidert Robin
die Umarmung, bis sie ihn schließlich freigibt. Vermutlich bin
ich die Einzige, die das selige Grinsen bemerkt, das über sein
Gesicht huscht. Prinz William ist ebenfalls aufgestanden. Auch
er hat große Ähnlichkeit mit dem Vater, wirkt wie eine ruhigere,
schüchterne Version von ihm. Die gebleichten Haare fallen ihm
in die Stirn.
»Guten Morgen, Miss Emris«, sagt er förmlich, greift nach
meiner Schleppe statt meiner Hand und haucht einen Kuss darauf.
Ich sinke in einen Devotionsknicks. Leichte Übelkeit breitet
sich in mir aus.
»Oh, bitte, Will, lass uns mit diesem Schleppenquatsch erst
anfangen, wenn wir wieder im öden England sind«, protestiert
Victoria und drückt mich an sich. Obwohl ihre Arme ziemlich
kurz sind, ist das die stürmischste Umarmung, die ich je genießen
durfte. Sie lässt Erinnerungen an ein Holzhaus an der Ostküste
in mir aufsteigen, an ein kleines Kind, das vor vielen Jahren
mit Bruder und Mutter im Garten spielte. »Wir sind doch
schließlich so etwas wie Schwestern, oder?«, sagt sie.
»Hoheit«, rügt Mister Galahad.
»Das reicht jetzt, Nerverl«, meint auch Robin und sieht sich
verstohlen um. Schon jetzt haben wir die allgemeine Aufmerksamkeit
auf uns gezogen. Er beugt sich zu seiner Schwester. Da
Victoria mich noch immer festhält, kann ich hören, wie er ihr
zuraunt: »Wenn wir uns heute mit Count Nottingham treffen,
dürfen wir uns keinerlei Indiskretion erlauben.«
Während Victoria sich auf ihren Platz setzt, wirft er mir einen
besorgten Blick zu, sagt aber nichts. Wir haben bereits über
Count Nottingham gesprochen; Robin kennt ihn nicht gut,
weiß aber, dass Nottingham nachgesagt wird, sich vor allen Dingen
in Geheimdienst- und Militärkreisen zu bewegen. Grund
genug, ihm gründlich zu misstrauen, da sind wir uns beide einig.
Denn wir sind zwar unter dem Vorwand nach Berlin gekommen,
hier seine Geschwister zu treffen, um dann mit ihnen
gemeinsam nach England zu reisen. Aber das ist nicht der wahre
Grund unseres Besuches.
Sondern der Seidene Hof.
»Dort kann man uns helfen«, erklärte Robin flüsternd, als wir,
noch in Paris, gemeinsam im Bett lagen. Angespannt ließ er die
Finger über meine Handfläche gleiten. »Der Seidene Hof könnte
uns dabei helfen, den Umsturz auf unsere Weise herbeizuführen,
und nicht so, wie sie ihn gerne hätte.«
Sie hat sich bei mir gemeldet. Das tut sie ständig. Mein Telefon
vibriert, als gerade der Tee eingeschenkt wird. (Der gnadenvolle
René bestellt sich eine Riesenportion Pfannkuchen und
eine Kanne Kaffee und teilt beides mit mir.) Ich werfe nur einen
kurzen Blick auf das Display.
Verschlüsselte Nachricht. Der Absender ist klar.
Viel Glück heute.
Madame Hiver.
Am liebsten würde ich ihr als Antwort einen Kraftausdruck
schicken, den ich in der Seidenhöhle gelernt habe: Leck mich.
Doch bevor ich es ernsthaft in Erwägung ziehen kann, kommt
schon die nächste Nachricht.
Seid vorsichtig. Sehr vorsichtig.
Ich runzele die Stirn. Robin wirft mir einen fragenden Blick
zu, aber ich schüttele nur den Kopf, will ihn nicht beunruhigen.
Wenn allerdings Madame Hiver wegen Count Nottingham
ebenfalls besorgt ist, ist es doppelt angebracht, keine Indiskretion
zu riskieren. Sie kennt sich in Geheimdienstkreisen noch
besser aus als wir. Schnell beuge ich mich zu René hinüber und
bitte ihn, mir nachher mit meinem Make-up zu helfen. Und
als Victoria das nächste Mal etwas zu laut wird, muss ich mich
zurückhalten, um ihr nicht ebenfalls über den Mund zu fahren.
Sobald das Frühstück beendet ist – das mit einer fantastischen
Speisenfolge aufwartet, unter anderem Crêpe-ähnlichen Pfannkuchen
mit eingebackenen Apfelstückchen und Zimt oder verschiedenen
dunklen Brotsorten, auf die man erst Butter streicht,
bevor man den Käse darauflegt (es ist auch diverses Fleisch im
Angebot, das ich allerdings meide) – , kehren wir kurz auf unsere
Zimmer zurück. René geht mir beim Make-up zur Hand. Robin
hält es ungefähr fünf Sekunden lang aus, dann greift er ein. Die
beiden diskutieren eine ganze Weile über Grundierung, Highlighter
und Ähnliches, bis ich mich hörbar räuspere. Letzten
Endes übernimmt Robin die Feinarbeit. »Woher kannst du das?«
Leichte Röte steigt in seine Wangen. »Die Verbannten haben
es mir gezeigt.«
Er meint die Theatertruppe, deren Vorstellung wir in den
Heiligen Höfen von London besucht haben. Sie sind momentan
auch in Berlin und geben ihr letztes Gastspiel, bevor sie wie
wir nach London zurückkehren. Dass wir sie hier noch einmal
auf der Bühne erleben werden, ist nur ein schwacher Trost. Ich
beobachte Robins Gesicht im Spiegel – so konzentriert, eifrig.
Seine Augen funkeln richtig. »Irgendwann musst du mir mal
verraten, was das ist mit dir und dem Theater.«
»Da habe ich eine bessere Idee. Irgendwann könnten wir
unsere eigene Truppe gründen.«
Ich lache laut auf. »Zunächst einmal hat das nackte Überleben
für mich Priorität.«
Seine Miene bleibt ernst. »Und doch wär’s ein Wunderding.«
Wieder lache ich darüber, trotzdem bleibt die Idee hängen,
während wir in die Lobby hinuntergehen und in die bereitstehende
Limousine steigen. Unsere eigene Schauspieltruppe.
Oh, Maria! Was würde meine Mutter sagen, wenn sie mich
hören könnte?
Nicht meine Mutter, rüge ich mich. Madame Hiver.
René kommt nicht mit. Blanc und der Comte haben ihm vor
seiner Abreise eindringlich klargemacht, dass er sich in nichts
verwickeln lassen darf, was auch nur annähernd gefährlich sein
könnte. So sitze ich nun allein mit Robin auf unserer Seite der
Limousine. Wir haben die Finger ineinander verschränkt, tragen
aber Handschuhe. Gegenüber sitzen Prinzessin Victoria, Prinz
William und Mister Galahad. Wir sind alle angespannt, aber bei
Mister Galahad ist es am schlimmsten. Immer wieder rutscht er
auf seinem Sitz herum, entschuldigt sich dann murmelnd bei
den Hoheiten, wirft mir verstohlene Blicke zu, wenn er denkt,
dass ich es nicht bemerke. Seit der Gedankenkontrolle ist er nicht
mehr derselbe. Manchmal frage ich mich, ob er noch unter Folgeerscheinungen
leidet, obwohl er danach von äußerst fähigen
Maltorologen behandelt wurde – Maltoren, die auch Medizin
studiert haben. Sie haben ihm versichert, dass sein Geist vollkommen
wiederhergestellt sei, als wäre nie etwas passiert. Das
hat mich sehr erleichtert, da es bedeutet, dass auch Ninon und
ich damals in der Stahlkammer keine bleibenden Schäden in seinem
Geist hinterlassen haben.
Aber ich habe auch gehört, wie die Maltorologen miteinander
getuschelt haben, dass diese Gedankenkontrolle einfach perfekt
gewesen sei, fast schon kunstvoll. Um sie aufzuheben, mussten
sie das gedankliche Gewebe zerstören, von dem sie umgeben war,
inklusive der verknüpften Erinnerungen, weshalb es hinterher unmöglich
war, den Schuldigen zu identifizieren. Madame
Hiver überlässt eben nichts dem Zufall. Während der Fahrt
wird mir bewusst, wie sehr ich Paris vermisse, obwohl ich mich
auch in Berlin bereits verliebt habe. Diese Stadt hier ist so …
anders. Selbst ihre breiten Boulevards unterscheiden sich von
denen anderer Hauptstädte. Hier gibt es mehr Schatten, mehr
schummrige Ecken. Wie aus dem Nichts tauchen immer wieder
Gebäude auf, die gar nicht zu ihren Nachbarn passen. Die
einem zuzuzwinkern scheinen, klein und schmal und heruntergekommen,
wie sie sind. Überall stehen Litfaßsäulen herum, auf
denen offizielle Ankündigungen in einer Flut von Aufklebern
und Pamphleten untergehen.
Während wir vorüberfahren, grinsen sie mich an, fast so, als wüssten sie,
dass ich mir am liebsten die Nase an der Scheibe platt drücken würde, um das alles zu
lesen – Konzerte im Untergrund. Dichterlesungen. Öffentliche
Wochenmärkte. Illegale Wettkämpfe. (Auch im Fechten, was ich
sofort dem Comte schreibe. Dabei finde ich eine Nachricht von
Liam: Wünschte, du wärst hier. Dazu ein Foto des viel zu weißen
St. James’s Parks.) Es gibt so viel zu sehen, so viel zu tun.
Irgendwie kann ich noch nicht wirklich glauben, dass wir
nicht hierbleiben werden. Dass Robin und ich nicht einfach
die nächsten zwei Jahre in der Welt herumreisen werden. Oder
dass ich nicht mal eben mit Liam einen Wochenendausflug nach
Salzburg machen kann. Dass Ninon und ich nicht ein Jahr lang
ziellos von einer Stadt zur nächsten gondeln dürfen.
Stattdessen kehren wir in den Gläsernen Turm zurück.
Ich verflechte meine Finger mit Robins. Das englische Königshaus
hat keine Ahnung, was auf sie zukommt.
Bis zum Palast der Kaiserin ist es nicht weit. Robin hat ihn
mir beinahe ehrfürchtig beschrieben. Er war das letzte Mal dort,
als die neue englische Botschaft eingeweiht wurde. Früher war
sie in direkter Nachbarschaft des Altair, ist dann aber auf der
Prachtstraße ein Stück aufgerückt, als Räumlichkeiten direkt im
Palast bereitgestellt wurden. Nun befindet sie sich in dem opulenten
Stadtschloss: drei Stockwerke mit hohen Fenstern, einer
mittig in der Front gelegenen Kuppel und wie von Grünspan
eingefärbtem Dach. In gewisser Weise sieht es aus wie das genaue
Gegenteil der grellen, frechen Litfaßsäulen: Sie arbeiten, während
das Schloss über ihnen thront. Sie spotten, wo das Schloss
majestätischen Glanz verströmt.
Wir werden bis vor den Eingang gefahren. Dort warten bereits
acht Ritter der Garde Ihrer Majestät auf uns. Sie tragen
die gleichen Abzeichen wie die Mousquetaires in Paris: einen
geöffneten Kreis in allen Farben des Regenbogens. Es tut gut,
ihn zu sehen.
Mister Galahad geht vorweg. Drinnen sind Wände und Teppich
überraschenderweise komplett schwarz. Trotzdem ist es
nicht dunkel, denn überall sind funkelnde Lichter angebracht
worden, nicht nur an der Decke, sondern auch an den Wänden
und im Boden. Es fühlt sich an, als wandere man umgeben von
Sternen durch den Nachthimmel. Sie bilden Muster und Konstellationen,
dichte Kreise wie die Andromeda-Galaxie, Bänder
wie die Milchstraße, breite Fächer wie der Schweif eines Kometen.
Rechts und links fließt Wasser durch zwei schmale Kanäle.
Es ist silbern, als wäre es mit feinem Glitzerstaub versehen. Doch
alles ist lautlos. Es herrscht absolute Stille. Oder dringt da ein
Pulsschlag durch den Boden? Pulsiert das Wasser? Die Wände?
Es hat etwas Magisches an sich, so durch die Nacht zu schreiten.
Magisch, aber auch verstörend. Ich verliere völlig die Orientierung,
weshalb ich erschrocken zusammenzucke, als wir plötzlich
stehen bleiben. Einer der Ritter streckt die Hand aus. Wenn
ich die Augen zusammenkneife, kann ich den Umriss einer Tür
erahnen. Ist der Korridor hier zu Ende?
»Vorsicht«, murmelt Robin, als er ein letztes Mal meine Hand
drückt. Ich will ihn gerade fragen, was er damit meint, als der
Ritter plötzlich die Tür öffnet.
Das Licht trifft mich wie ein Schlag in den Magen. Ich weiche
einen Schritt zurück, hebe abwehrend die Hände. Robin rückt
etwas näher an mich heran, wohl um mich abzuschirmen, aber
er hat selbst zu kämpfen. Licht und Musik, laute Musik. Im ersten
Moment klingt es bloß wie Lärm, doch dann erkenne ich ein
Saxofon, ein Klavier, alles abgemischt. Elektro-Swing. Vor uns
befindet sich ein prachtvoller Saal voller wild tanzender Menschen.
Sie werfen sich gegenseitig in die Luft, lassen sich über
den Boden gleiten, wirbeln herum. Artisten hängen, nur von
Stoffbahnen gehalten, unter der Decke, in zehn Metern Höhe
spazieren Seiltänzer herum oder gleiten an Stangen auf und ab
wie Mensch gewordenes Wasser. Das helle Licht ist weiß wie das
eines blendenden Mondes. Es stammt von großen Kugeln, die
scheinbar schwerelos in der Luft hängen. Sie sind so dick, dass
nicht einmal zehn Männer sie mit ausgebreiteten Armen umfassen
könnten. In diesem Saal haben sich die unterschiedlichsten
Menschen versammelt, eine solche Vielfalt habe ich noch nie
gesehen.
Mister Galahad geht als Erster hinein, gefolgt von Prinzessin
Victoria, die ein leises Quietschen ausstößt. Noch immer
leicht desorientiert trete ich hinter Robin über die Schwelle. Die
Kanäle an den Seiten markieren auch hier einen Weg, der sich
mitten durch den Saal zieht. Rechts und links sehe ich Tänzer,
Künstler und Wachen, aber auch Höflinge. Manche sitzen an
leuchtenden, kugelförmigen Tischen und beobachten das Spektakel.
Alle tragen glitzernde Kleider und Anzüge, dazu ausladenden
Federschmuck – Frauen wie Männer. Wobei einige auch
einen Teil ihrer Kleidung eingebüßt haben, ähnlich wie das Publikum
in der vergangenen Nacht. Ich kann einfach nicht den
Blick von ihnen abwenden. Doch der spektakulärste Anblick
wartet am Ende des Saals: ein Thron. Ein Thron, der komplett
aus Diamanten besteht und über mehreren Wasserbecken aufragt,
umgeben von Lichtkugeln.
Auf diesem Thron sitzt Kaiserin Dana. Erst als wir dicht vor
ihr stehen, bemerke ich, dass sie uns anlächelt. »Willkommen,
meine Enkel, Miss Emris, Mister Galahad«, begrüßt sie uns auf
Englisch. Ich hatte ganz vergessen, wie tief ihre Stimme ist. Sie
ähnelt sehr der ihres Enkels, des Kronprinzen. »Willkommen am
Neuen Hof.«
Sie trägt eine Krone aus Diamanten, die wie ein Sternbild
auf ihrem alten Kopf schimmert. Kleid und Mantel sind gerade
geschnitten und umspielen sie wie ein silberner Kometenschweif.
Diener sorgen mit großen Federfächern für Kühlung, reichen ihr
Trauben und Wein. Ihre braune Haut schimmert, weil eine Dienerin
ihr gerade eine klare Lotion auf Arme, Hände und Gesicht
schmiert. »Ich hoffe, dir gefällt es in Berlin, Robin? Und Ihnen
ebenfalls, Fräulein Emris?«
»Es ist fantastisch«, bringe ich stammelnd hervor. Sie ist eine
wirklich beeindruckende Frau. Als sie sich ein kleines Lächeln
gestattet, bekomme ich einen Eindruck davon, wie eine grinsende
Raubkatze aussehen muss. »Etwas Derartiges haben Sie
sicherlich noch nie gesehen, oder?«
Ich blicke mich noch einmal im Saal um. Ganz sicher nicht.
Diese Vielfalt an Menschen, von den Höflingen über die Tänzer
und Artisten bis zur Kaiserin selbst … »Nein, nicht einmal annähernd,
Eure Kaiserliche Hoheit.«
»Wir danken Euch für Eure Gastfreundschaft«, ergänzt Robin,
was die Kaiserin mit einem Nicken zur Kenntnis nimmt. »Uns
und unseren Geschwistern gegenüber. Wir würden unseren Aufenthalt
hier nur zu gerne noch weiter ausdehnen, in Eurer Stadt
ebenso wie in Eurem Palast. Und natürlich wären wir gerne
nur zum Vergnügen gekommen, ohne einen protokollarischen
Anlass.«
Ich bemerke, wie William seinem Bruder einen beeindruckten
Blick zuwirft. Die Kaiserin lächelt noch immer. »Du bist
ungeduldig, Robin. Das gefällt mir. Ganz wie deine Mutter,
würde ich sagen. Und auch wie dein Bruder.«
William lässt den Kopf hängen, während die Kaiserin den
Blick durch den Saal schweifen lässt und dann die Hand hebt.
»Dann also zum protokollarischen Teil. Begrüßt mit mir einen
weiteren Freund in der Runde: Sir Vaisey, den Count von Nottingham
und Hannover.«
Meine Muskeln spannen sich an. Vorsichtig sehe ich mich
um, suche nach einer großen, Furcht einflößenden Gestalt.
Nach einem Lächeln, das kein Lächeln ist. Ich bin bereit, meinem
Feind ins Gesicht zu sehen und mit freundlicher
Miene seinen Untergang zu planen.
Aber es erscheint niemand auf dem Weg in die Mitte des
Saals. Und es dauert einen Moment, bis mir bewusst wird, dass
Mister Galahad und Robin sich zur Seite gedreht haben. Dass sie
gar nicht auf den Weg schauen.
Sondern auf die Tanzfläche.
Da, ziemlich weit in der Mitte. Ein großer Mann. Gerade
schleudert er eine Frau in die Luft, rutscht über den Boden,
fängt sie wieder auf. Beide wirbeln herum, er wirft sie, fängt sie,
läuft rückwärts. Dann stürmen sie aufeinander zu, sie springt, er
hebt sie hoch über den Kopf. Ohrenbetäubender Applaus setzt
ein. Er dreht sich im Kreis, genießt ihren Triumph.
Erst als die Musik aufhört, setzt er seine Partnerin ab. Die beiden
verbeugen sich voreinander, und unter dem Jubel der Menge
verlässt er die Tanzfläche. Er kommt auf uns zu. Er ist groß,
er lächelt. Helles Haar, dunkle Augen. Überraschenderweise ist
er nicht völlig glatt rasiert, sondern trägt einen schmalen Bart,
der sich in einer sorgsam gestutzten Linie über den Bogen des
Unterkiefers und das Kinn zieht. Er verleiht seinem Gesicht eine
maskuline Eleganz, die ich bei einem solchen Mann nicht erwartet
hätte.
»Kaiserliche Hoheit, Hoheiten! Welch eine Ehre! Welch eine Freude!«
Robin will etwas erwidern, aber der Mann wendet sich schon
wieder von ihm ab. Und mir zu. Seine Wangen sind gerötet, und
seine Augen funkeln, als er sich vor mir verbeugt. »Miss Emris.
Das ist wohl die größte Ehre von allen.« Der Count of Nottingham,
Mister Galahads Cousin, ignoriert sie alle, jeden einzelnen
von ihnen, und streckt mir die Hand entgegen.
»Darf ich bitten?«
Seine Hand ist nackt.
Hol dir jetzt den dritten Teil der hinreißenden Trilogie!
Jetzt bestellen
Endlich: der vierte Teil der Reihe!
Jetzt bestellen
Steckbriefe
Rea
Name: Rea Marian Emris
Titel: keiner
Deckname: Roter Kardinal
Beruf: Schneiderin
Hobbys: Faustkämpfe, Theater, schauspielern, backen
Held der Kindheit: meine Mutter
Das mache ich, wenn mir niemand zuschaut: die Handschuhe ausziehen
Das ist mein größtes Geheimnis: …………………………
Das ist meine größte Furcht: für immer allein zu bleiben
Robin
Name: Robin
Titel: Seine Königliche Hoheit Prinz Andrew Reginald Theodor Ulysses Robin, Kronprinz von England und Wales, Erbe des Neuen Hauses Tudor
Deckname: Locksley
Beruf: Kronprinz
Hobbys: Bogenschießen, Theater
Held der Kindheit: Robin Hood
Das mache ich, wenn mir niemand zuschaut: eine Maske aufziehen und heimlich durch die Stadt streifen
Das ist mein größtes Geheimnis: ……………………………
Das ist meine größte Furcht: alle zu enttäuschen
Ninon
Name: Ninon
Titel: Ihre Durchlaucht Gräfin Ninon von Orléans, Schwester des Königs von Frankreich
Deckname: Mademoiselle Morgana
Beruf: CEO von M3RL1N, des größten Tech-Konzerns des Kontinents
Hobbys: tanzen, essen, programmieren, shoppen, lesen
Held der Kindheit: Ada Lovelace
Das mache ich, wenn mir niemand zuschaut: die schöne Kleidung ablegen, den Schmuck, die Schminke, und einfach lesen; und geheime Algorithmen programmieren
Das ist mein größtes Geheimnis: …………………………….
Das ist meine größte Furcht: dass ich einen unverzeihlichen Fehler begangen habe
Blanc
Name: Blanc
Titel: Hauptmann und Mousquetaire
Deckname: Mister Lancelot, White Knight
Beruf: Hauptmann der Königlichen Garde
Hobbys: Trainingskämpfe, kochen
Held der Kindheit: James Noah, der Schwarze Rauch
Das mache ich, wenn mir niemand zuschaut: mit meinen Dämonen kämpfen
Das ist mein größtes Geheimnis: ……………………………
Das ist meine größte Furcht: niemals mit den Menschen zusammen sein zu dürfen, die ich liebe
René, Mousquetaire
Name: René
Titel: Mousquetaire du Roi
Deckname: /
Beruf: Militärarzt
Hobbys: Schachspiel, Kochen, Ausgehen, Tanzen
Das mache ich, wenn mir niemand zuschaut: Musik hören
Das ist mein größtes Geheimnis: ……………………………
Das ist meine größte Furcht: Mich eines Tages opfern zu müssen
Der Comte
Name: Olivier
Titel: Comte de l’Aisne
Deckname: /
Beruf: Mousquetaire du Roi, Lieutenant
Hobbys: Fechten, Schachspiel, Lesen
Das mache ich, wenn mir niemand zuschaut: Nachdenken
Das ist mein größtes Geheimnis: ……………………………
Das ist meine größte Furcht: Die Kontrolle zu verlieren
Madame Hiver
Name: /
Titel: /
Deckname: /
Beruf: Mätresse des Roi; französischer Geheimdienst (?)
Hobbys: Tanz, Messerkampf
Das mache ich, wenn mir niemand zuschaut: Ich blättere in alten Fotoalben
Das ist mein größtes Geheimnis: ……………………………
Das ist meine größte Furcht: Dass ich mein Ziel nicht erreichen werde