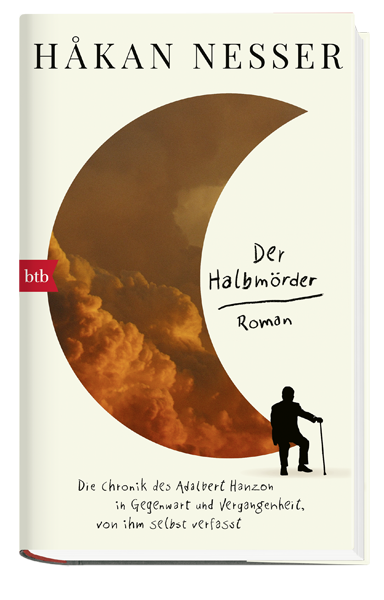1
Zwei Mieter wohnen in meinem Kopf. Sie leben dort seit Langem, bezahlen keine Miete und ziehen niemals aus. Ihre Namen sind Schuld und Scham, sie müssen erwähnt werden, und jetzt ist es getan.
Aber ich möchte meine Chronik nicht mit diesen beklemmenden Begleitern einleiten, da verliere ich gleich den Mut. Ich schiebe sie in die Zukunft, vielleicht bis ans Ende, und beginne stattdessen mit einem anderen Namen. Meinem eigenen.
Ich heiße Adalbert Hanzon.
Es gab eine Zeit, in der ich Bert Hansson hieß, aber das ist lange her. Heute bin ich dreiundsiebzig, und mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es einmal war. Vielleicht bin ich auch einen Hauch dement, aber falls es so sein sollte, habe ich keine Lust, mich näher damit zu befassen. Dazu besteht keine Veranlassung, und ich versuche, meinem mentalen Verfall entgegenzuwirken, so gut es eben geht. Mit der Zeit werde ich auf das eine wie das andere zurückkommen, aber das ist kein Versprechen. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, und es ist nicht gesagt, dass es mir gelingt, die Sache glücklich zu Ende zu bringen, aber seit einiger Zeit treibt mich ein innerer Zwang an, es wenigstens zu versuchen. Dafür gibt es gute Gründe.
Ich sitze an meinem Küchentisch. Es ist ein grauer Vormittag in der ersten Septemberhälfte. Durch das Fenster kann ich Henry Ullberg sehen, der auf der anderen Straßenseite aus seiner Haustür tritt und sich mit seinem Rollator in Richtung Marktplatz und Einkaufsmöglichkeiten schleppt. Er geht jeden Tag einkaufen, auch wenn es gar nicht nötig ist. Manchmal sehe ich ihn mit kaum mehr als einer Tüte Möhren und einer Zeitung zurückkommen.
Henry Ullberg ist im Großen und Ganzen der einzige Mensch, mit dem ich in Kontakt stehe. Er ist sturer als ein Esel. Wir treffen uns ungefähr einmal im Monat, meistens bei ihm, weil ihm das Gehen schwerfällt, wenn er besoffen ist. Und besoffen werden wir immer, wir trinken nämlich Drinks, die wir aus Single Malt Whisky und Trocadero mixen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, die Getränke zu variieren, aber Henry, dieser starrsinnige Dickkopf, weigert sich. Und weil er stets den Whisky beisteuert, mache ich gute Miene zum bösen Spiel. Sein Sohn Robert schickt ihm das Gesöff aus Schottland, wo er als eine Art Jurist arbeitet. Er hat seinen Vater seit fünfzehn Jahren nicht mehr besucht, aber die Pullen kommen regelmäßig an.
Bei unseren Trinkgelagen zerstreiten wir uns häufig, Henry Ullberg und ich, und beschließen fast immer, uns nie wieder zu sehen. Er ist jedoch genauso einsam wie ich, und nach zwei oder drei Wochen greift deshalb immer einer von uns zum Telefonhörer und schlägt vor, dass wir demnächst einen Drink nehmen und ein bisschen quatschen. Meistens rufe ich an, Henry ist generell ein ziemlich zugeknöpfter Typ. Er ist etwas älter als ich, und wir kennen uns seit mehr als vierzig Jahren. Gott sei Dank haben wir uns nicht durchgehend gesehen, aber während einer ziemlich langen Zeitspanne war es täglich und sogar stündlich. Ob wir wollten oder nicht, auch darauf werde ich zurückkommen.
Das Schreiben zehrt an meinen Kräften. Ich sitze hier gerade einmal eine halbe Stunde, bin aber bereits erschöpft und ein wenig entmutigt. Ich bringe meine Worte in einem ziemlich großen Notizbuch mit einem festen, gelben Einband zu Papier. Ich besitze vier Stück davon, gekauft im Sommerschlussverkauf, ohne zu wissen, wofür es gut sein sollte. Ich schreibe nur auf den rechten Seiten, das habe ich vor vielen Jahren bei meiner ersten und einzigen Begegnung mit einem professionellen Schriftsteller gelernt. Es war ein halbwegs berühmter schwedischer Autor, eine Frau schleifte mich dorthin; mir fallen gerade ihre Namen nicht ein, weder der des Schriftstellers noch der der Frau. Dagegen erinnere ich mich, dass ich mitten in seinem Vortrag eingeschlafen bin. Die Frau, sie war groß und rothaarig, weckte mich mit einem ärgerlichen Ellbogenschubser, als es Zeit war zu applaudieren, also muss er das, nur auf den rechten Seiten zu schreiben, am Anfang gesagt haben. Er war übrigens groß und erinnerte mich ein bisschen an einen alten Bandyspieler aus meiner Heimatstadt, der Frasse Finkel hieß. Manche Namen sitzen wie Warzen in der Erinnerung, und jetzt mache ich eine Pause und lege mich im Wohnzimmer einen Moment hin.
Ich habe eine Methode, um gegen das Vergessen anzukämpfen. Man sagt ja, dass das Gehirn beschäftigt werden muss, damit es nicht völlig einrostet. Es tut ihm einfach gut, zu arbeiten und sich anzustrengen, deshalb versuchen Menschen in meinem Alter wohl auch, auf unterschiedliche Weise aktiv zu bleiben. Man löst Sudokus und Kreuzworträtsel, man nimmt an Preisausschreiben teil, man bloggt, schreibt Beiträge für den Eurovision Song Contest und wird Mitglied im Verein der vitalen Senioren. Abgesehen von den Kreuzworträtseln spricht mich nichts von all dem an. Aber ich lese recht viel und schaue die Fernsehnachrichten, das reicht mir völlig.
Meine Methode, mich besser zu erinnern, besteht darin, mir ins Gedächtnis zu rufen, wie manche Leute heißen. Oder hießen, falls sie schon tot sind, was häufig der Fall ist.
Sonntagabends greife ich nach einem Papier (halbsteifer Karton, Postkartenformat, ich besitze einen Vorrat davon) und schreibe eine Liste mit sieben Personen. Auf der einen Seite notiere ich eine kurze Beschreibung der fraglichen Person, auf der anderen ihren Namen. Zum Beispiel: Der Mann, der im Fernsehen Löffel verbogen hat – Uri Geller.
In der folgenden Woche lese ich jeden Morgen die Beschreibung und versuche anschließend, mich an den Namen zu erinnern. Natürlich ohne das Blatt umzudrehen und mir die Auflösung anzuschauen. Ich darf erst aufstehen, wenn ich mindestens sechs geschafft habe. Manchmal dauert das ziemlich lange, das gebe ich gerne zu.
So sieht die Liste für die laufende Woche aus:
Das deutsche Spionweib – Mata Hari
Der Typ, der den Schlager 34 gesungen hat – Per Myrberg
Linker Mittelfeldspieler bei Djurgården und in der Nationalmannschaft – Sigge Parling
Der erste Mann auf dem Mond – Neil Armstrong
Meine Handarbeitslehrerin – Elvira Stalin
Die Frau, die im Fernsehen immer mit dem Handrücken winkte – Ria Wägner
Dieser Fensterputzer – Gösta Pumpman
Es kann sich also um allseits bekannte Menschen handeln wie Sigge Parling oder Neil Armstrong – aber auch um Leute, zu denen ich eine persönliche Beziehung hatte und von denen kein anderer jemals gehört hat. Zum Beispiel Elvira Stalin und Gösta Pumpman; Letzterer schuldet mir übrigens immer noch fünf Kronen, aber da er mittlerweile tot sein dürfte, werde ich sie wohl niemals zurückbekommen.
Wenn man an jemanden denkt und anfängt, sich die Person vorzustellen, taucht das Individuum selbst ja meistens lange vor dem Namen auf. Man sieht sozusagen den ganzen Menschen vor seinem inneren Auge, und obwohl man sich an eine Menge Details und Zusammenhänge erinnert, ist es manchmal verflucht schwer, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie dieser Bursche hieß, der 34 gesungen hat. Oder diese hinkende Handarbeitslehrerin, die später, lange nach ihrer Pensionierung, zwischen Flen und Katrineholm vom Zug überfahren wurde. Jedenfalls funktioniert es in meinem Schädel so, und es hilft nicht immer, dass ich den Namen einen oder drei oder sechs Tage vorher auf ein Blatt geschrieben habe. Und wenn ich mich nun anschicke, die Geschichte zu erzählen, die ich mir zu erzählen vorgenommen habe, ja, wie um Himmels willen soll das gehen?
Aber es ist nun einmal so, dass ich spüre, ich muss es tun. A man’s gotta do what a man’s gotta do. Man muss es zumindest versuchen; es geht ja auch gar nicht darum, das Ganze einfach nur zu erzählen, es gibt da vielmehr ein paar Dinge, die genauer untersucht werden müssen. Ein Rätsel, würde ich beinahe behaupten wollen, und es erfordert wohl einen so aufgeblasenen Idioten wie mich alten Schreiberling, um einen derart zum Scheitern verurteilten Auftrag zu übernehmen.
Hier weiterlesen