Sie kennt ihn nicht. Doch er weiß alles über sie.
Hier reinlesen
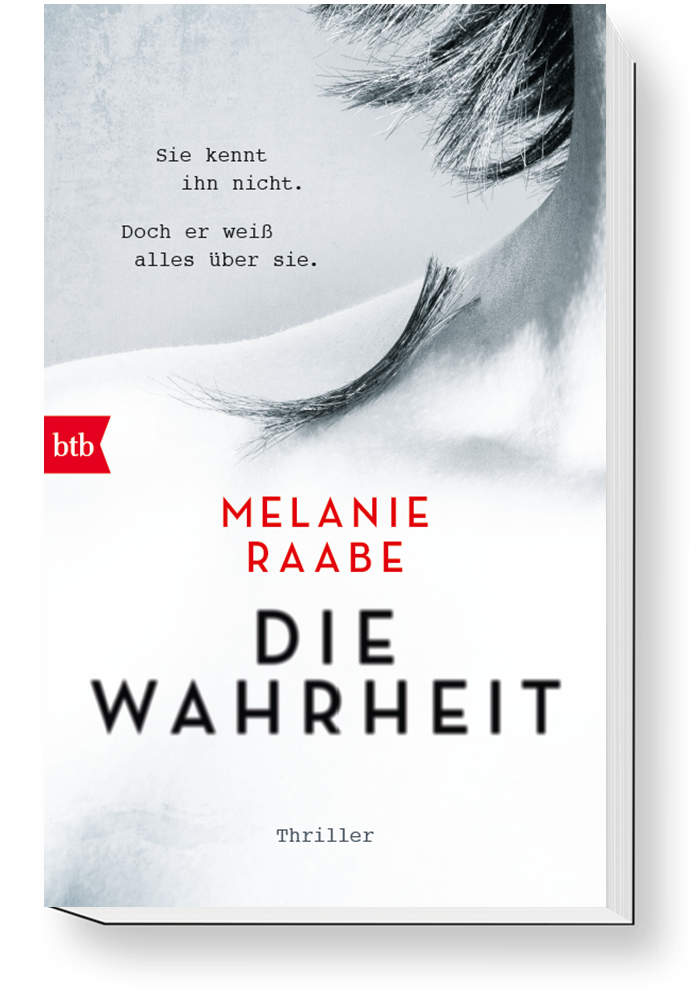
Die Welt ist schwarz.
Die Sonne über mir ist schwarz. Ich stehe da, den Kopf in den Nacken gelegt. Die Augen weit offen. Ich versuche, den Moment ganz in mich aufzunehmen. Ihn mir zu merken. Keine anderen Gedanken zuzulassen. Die Bäume rauschen leise, es klingt fast feierlich. Nur die Vögel in ihren Wipfeln zeigen sich unbeeindruckt von dem, was gerade geschieht. Sie singen gegen die Dunkelheit an, als ob es um ihr Leben ginge. Die Sonne ist schwarz, und ich stehe da und bade mich in ihrem Anblick. Es gibt keine Wärme mehr. Kein Licht.
Dies ist nicht die erste Sonnenfinsternis, die ich erlebe. Die Erinnerung an meine erste macht mich lächeln – trotz allem. Philipp hatte damals aus der Stadt gewollt, in den Wald. Er hatte wissen wollen, ob seine Vermutung, dass die Vögel bei einer Sonnenfinsternis schlagartig aufhören zu singen, stimmte. Aber ich wollte in der Stadt bleiben. Das Spektakel mit unseren Freunden genießen. Wir alle gemeinsam, jung, albern und aufgekratzt, mit unseren Spezialbrillen auf den Nasen. Ich über redete ihn. Es war nicht schwer, Philipp ließ sich damals immer gerne von mir zu allem Möglichen überreden. Er startete einen letzten Versuch. Sagte, dass es alleine und im Wald viel romantischer sei. Ich sagte: »Sei nicht kitschig!«, und er lachte. Wir blieben also. In der Stadt, bei unseren Freunden.
Seltsam ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie die verdunkelte Sonne aussah. Ich erinnere mich an alles drum herum, an das Geschnatter unserer Freunde, an die Musik, die aus dem Radio kam. Ich erinnere mich, dass es verbrannt roch, weil irgendwer den Grill angeworfen und Würstchen darauf vergessen hatte, ich erinnere mich an Philipps Hand in meiner. Ich erinnere mich, dass wir die Brillen irgendwann abnahmen, weil sie beim Küssen störten. Wir hatten einander bei den Händen gehalten und den Moment wohl einfach verpasst. Und zum ersten Mal hatten wir über die Zukunft gesprochen. Was ich zuvor immer abgelehnt hatte, weil ich nicht glaubte, dass es das gab: die Zukunft. Aber wir hatten gehört, dass die nächste Sonnenfinsternis in unseren Breiten im Jahr 2015 kommen würde und die übernächste erst im Jahr 2081. Und das war konkret, das konnte ich glauben. Also hatten wir ausgerechnet, dass Philipp bei der nächsten Sonnenfinsternis fast vierzig wäre und ich immerhin siebenunddreißig. Wir hatten gelacht über den schieren Irrsinn des Gedankens, dass wir einmal so alt sein könnten. Aber wir versprachen einander, dass wir beim nächsten Mal besser aufpassen würden, dass wir sie sehen würden, gemeinsam, die schwarze Sonne, und zwar im Wald, damit Philipp das überprüfen konnte. Diese Sache mit den Vögeln.
Ich stehe auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald. Allein. Ich bin siebenunddreißig Jahre alt. Ich starre eine riesige, schwarze Sonne an, sie starrt zurück, und ich frage mich, ob Philipp sie auch sieht. Ob man sie sehen kann, von dort, wo Philipp ist. Ich denke daran, dass unser Sohn bei der nächsten Sonnenfinsternis fünfundsiebzig Jahre alt sein wird. Dass ich nicht mehr da sein werde, dass Philipp nicht mehr da sein wird. Das hier, dieser Tag heute – das war unsere letzte Chance. Während ich so dastehe und der Mond sich die letzten paar Millimeter vor die Sonne schiebt, wird mir klar, dass Philipp Unrecht hatte. Das gefiederte Orchester um mich herum ist keinen Deut leiser geworden. Ich frage mich, ob ihn das enttäuscht oder gefreut hätte. Sage mir, dass das keine Rolle mehr spielt. Philipp ist nicht mehr da, denke ich. Philipp ist weg. Philipp ist verschwunden. Philipp ist vom Rand der Welt gefallen.
Und in diesem Moment hören die Vögel auf zu singen.
2
Der Friseur hat ein schönes Gesicht mit markanten Wangenknochen und schlanke, feminine Hände. Ich habe gezögert, den Salon zu betreten. Bin ein paar Mal bewusst daran vorbeigelaufen, bevor ich durch die Tür getreten bin.
Nun sitze ich hier, auf einem drehbaren Stuhl, und fühle mich ausgeliefert. Der Friseur fährt mit seinen Klavierspielerfingern durch meine Haare, die mir beinahe bis zur Hüfte reichen, einmal, zweimal, dreimal, mit gespreizten Fingern vom Ansatz zu den Spitzen. Er stößt bewundernde Laute aus, eine Kollegin, die sich als Katja vorstellt, kommt hinzu, befühlt ebenfalls meine Haare. Die Berührungen der beiden sind mir unangenehm, viel zu intim, es gab so viele Jahre lang nur einen, der meine Haare anfassen durfte, und er hat sie geliebt, er hat seinen Kopf auf ihnen gebettet, er hat mit ihnen seine Tränen getrocknet. Dennoch lasse ich den beiden ihren Spaß, tue so, als freute ich mich über ihre Komplimente. Irgendwann beruhigen sie sich, und Katja macht sich wieder daran, sich um die Extensions ihrer Kundin zu kümmern.
»Also«, sagt der Friseur, die Hand schon wieder in meinem Haar. »Spitzen schneiden?«
Ich schlucke einmal trocken.
»Alles ab«, sage ich dann.
Der Friseur, dessen prätentiösen Namen ich mir nicht merken kann, kichert kurz auf, verstummt, als er merkt, dass ich nicht mit ihm lache, dass das kein Scherz ist. Sieht mich an. Ich krame in meiner Handtasche, ich bin vorbereitet, ich finde die Seite, die ich aus einem Modemagazin gerissen habe, ziehe sie aus meiner Tasche, halte sie dem Friseur entgegen und tippe auf das Foto oben rechts.
»So«, sage ich. Und dann, wie um mir selbst Mut zu machen, noch einmal. »So. So will ich das.«
Der Friseur nimmt mir die Magazinseite aus der Hand, betrachtet sie, stirnrunzelnd erst, dann verschwindet die steile Falte, die seine Stirn in zwei Hälften geteilt hat. Er schaut mich an, dann schaut er noch einmal das Magazin an, schließlich nickt er.
»Okay.«
Ich atme auf, ich bin froh, dass ich ihn nicht erst überzeugen muss. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich hasse es, wenn andere meinen, besser zu wissen, was gut für mich ist, als ich selbst. Patrice, jetzt weiß ich den Namen des Friseurs plötzlich wieder, er heißt Patrice. Patrice ist Profi genug, mich nicht in Frage zu stellen. Er legt sein Equipment auf einem kleinen Frisiertisch bereit: verschiedene Scheren und Kämme, Bürsten, Fluids, Sprays und einen Fön mit verschiedenen Aufsätzen. Seinen kleinen Handspiegel, mit dem er mir später vermutlich zeigen will, wie meine Haare am Hinterkopf aussehen, legt er auf einen Magazinstapel. Aber der Spiegel rutscht von der glatten Oberfläche des Türmchens und fällt zu Boden. Patrice flucht, hebt ihn auf, dreht ihn herum, sieht das geborstene Glas.
»Zerbrochene Spiegel bedeuten sieben Jahre Pech«, sage ich.
Der Friseur schaut mich aus braunen Rehaugen erschrocken an, lacht dann ein nervöses Lachen. Ich bedauere meinen Kommentar, der lustig hatte klingen sollen, den Ärmsten aber anscheinend verschreckt hat. Wie schön es doch sein muss, das Pech noch zu fürchten. Das bedeutet schließlich, dass es noch nicht eingetreten ist. Ich könnte ein ganzes Spiegelkabinett zerschlagen, es würde mich nicht kümmern.
Vor sieben Jahren ist mein Mann auf einer Geschäftsreise nach Südamerika spurlos verschwunden. Seither halte ich die Pausen-Taste meines Lebens gedrückt und warte auf ihn. Sieben Jahre Hoffen und Bangen und ein Gefühl absoluten Verlorenseins, das manchmal so stark war, dass ich am liebsten jede Erinnerung an Philipp aus meinem Gedächtnis getilgt hätte. Obgleich auch das nichts genützt hätte. Das Vermissen war bereits in meine DNA übergegangen.
Sieben Jahre Pech habe ich bereits hinter mir.
Patrice holt einen neuen Spiegel, schweigend. Beginnt anschließend vorsichtig, die größten Scherben zusammenzuklauben, den Rest zusammenzufegen. Ich sage nichts mehr, lasse ihn einfach machen. Innerlich kämpfe ich meinen eigenen Kampf. Ich schließe die Augen, bewege meine Finger durch mein Haar, ganz zart, so als berührte ich kostbare Spitze. Vorsichtig. So wie meine Mutter, vor vielen, vielen Jahren, so wie Philipp früher – und seither niemand mehr. Philipp, wie er mit meinem Haar spielt. (…)
Sommer 2008
(…)
Er hatte es ihr wieder nicht gesagt. Hatte seinen Kaffee getrunken und dem Kind zugesehen, das mit Sarahs Hilfe durch die Küche tapste, auf seinen speckigen Beinen, die älteren Damen für gewöhnlich spitze Schreie des Entzückens entlockten. Hatte ihm zugeschaut, wie es beinahe über den Rand des cremefarbenen Teppichs gestolpert war, sich fing, weiter voranstrebte. Kurz war Philipp der Gedanke gekommen, was für ein Wunder es doch war, eine Frau und ein gesundes Kind zu haben, und dass er Dankbarkeit empfinden sollte, doch wie die meisten helleren Gefühle hatte sich auch dieses nicht so recht einstellen wollen. Das ist die Strafe, hatte er gedacht. Ich wusste, dass ich auf irgendeine Art und Weise bestraft werden würde für das, was ich getan habe, und das ist nun die Strafe.
Sarah wandte sich zu ihm um, als hätte sie seinen Blick im Rücken gespürt, rang sich ein Lächeln ab.
Frag mich, dachte er. Frag mich, ob ich okay bin. Wie es mir geht, irgendwas. Stell mir irgendeine von den blöden Fragen, die mich früher immer so genervt haben.
Doch Sarah hatte geschwiegen. Wieder einmal. Hatte sich mit dem Kind beschäftigt und ihn nicht mehr angesehen. In ihrem langen, offenen Haar war noch der Abdruck des Gummibands zu sehen gewesen, dort, wo es über Nacht zusammengehalten worden war. Er hätte es gerne berührt, ihr Haar. Auf dem Tisch hatten bunte Blumen gestanden, Ranunkeln, wenn er sich nicht irrte, der einzige Farbtupfer im monochrom cremefarben eingerichteten Raum. Das ganze Haus war so furchtbar beige, das war ihm früher nie aufgefallen. Als wäre etwas gekommen und hätte allen Dingen die Farbe entzogen. Lange Zeit hatten sie nichts an der Einrichtung, die seine Mutter ganz nach ihrem Geschmack gestaltet hatte, geändert, aus Respekt vor Constanze, die sich nach ihrem Umzug in eine kleinere, altersgerechte Wohnung immer mal wieder selbst zum Tee eingeladen und über die geringste Veränderung in »ihrem« Haus beklagt hatte. Und dann hatten sie es wohl irgendwann einfach aufgegeben, hatten sich eingerichtet in der hanseatischen Kühle, in der cremefarbenen Noblesse, die zu Constanze passte, aber nicht zu ihm – und zu seiner bodenständigen Frau, die kräftige Farben liebte, schon gar nicht. Beigefarbene Polstermöbel, viel altes Holz, gerahmte Stiche nautischer Motive an den Wänden.
Die Blumen, die Sarah Woche für Woche vom Markt mitbrachte, waren das Einzige, das den Räumen Farbe verlieh.
Er wunderte sich, dass sie immer noch die Zeit für diese Kleinigkeiten fand. Schöne, sinnlose Tätigkeiten. Blumen kaufen. Sie anschneiden und in Vasen arrangieren. Aber vielleicht waren es gerade diese vielen kleinen, scheinbar sinnlosen Tätigkeiten, die Sarah zusammenhielten.
Äußerlich war alles wie immer, doch die Dinge hatten ihre Selbstverständlichkeit verloren, nach dieser … dieser Sache. Er wusste nichts mehr. Nicht, wie man seiner Ehefrau übers Haar strich oder sie zum Abschied küsste, nicht, wie man mit seinem einjährigen Kind spielte, manchmal noch nicht einmal mehr, wie man ein- und ausatmete. Er fragte sich, wann die Dinge begonnen hatten, so aus dem Ruder zu laufen. Wirklich erst in dieser einen, verhängnisvollen Nacht? Oder bereits davor?
Philipp hatte beim Abschied mit sich gerungen.
Sollte er es ihr sagen? Er kämpfte mit sich. Sah den Zeigern der Küchenuhr bei der Verrichtung ihrer Arbeit zu, so lange, bis es zu spät war für das Gespräch, das er hätte führen müssen. Er hatte Sarah einen Kuss auf die Stirn gegeben und sich zum Gehen gewandt. (…)
13
(…)
Manchmal erscheint mir die Welt wie eine Kulisse. Wir treten auf das Rollfeld, weiß der Teufel, wie Hansen die Erlaubnis dazu erwirkt hat. Die kleine private Maschine mit Philipp und dem Team, das ihn begleitet, an Bord, wird etwas abseits vom normalen Flugverkehr der großen Airlines landen. Alle schwitzen, ich hingegen friere. Ich streiche mir durch mein kurzes Haar. Leo hüpft neben mir aufgeregt auf und ab, er liebt Flugzeuge. Trotz der Anspannung entlockt es mir ein Lächeln. Ich bin dankbar, dass ich die Landung der Maschine hier verfolgen darf, die Tatsache, dass neben uns auch ein gutes Dutzend Pressevertreter auf dem Rollfeld Aufstellung bezogen hat, ignoriere ich, so gut ich kann. Das ist nicht wichtig, das ist alles nicht wichtig.
Im Kopf wiederhole ich noch einmal die Sätze, die ich mir zurechtgelegt habe. Doch plötzlich, jetzt und hier, fühlen sie sich irgendwie falsch an, sie klingen unecht und gestelzt, wie Zeilen aus einem Monolog. Aber was soll ich ihm sonst sagen? Ich denke an mein Gespräch mit Leo heute Morgen und entschließe mich, meinen eigenen Rat zu beherzigen und einfach zu sagen, was ich fühle.
Schön, dass du wieder da bist, denke ich.
Ja. Das fühlt sich richtig an.
Schön, dass du wieder da bist.
Ich wiederhole den Satz lautlos, wie ein glückbringendes Mantra.
»Sind Sie okay?«, fragt Hansen, und ich nicke.
Ich weiß nicht, warum mich das in den letzten Tagen ständig alle fragen. Miriam, Martin, Frau Theis, sogar Leo. Mein Mann lebt. Natürlich bin ich okay!
Wir schweigen, stehen herum, wissen nicht recht, was wir sagen sollen.
»Dort«, sagt Hansen neben mir und macht eine Geste Richtung Himmel.
Ich folge seinem Blick und sehe ein Flugzeug im Anflug.
Ich nehme die Hand meines Sohnes, gemeinsam blicken wir der Maschine entgegen.
Schön, dass du wieder da bist, denke ich, während das Flugzeug zur Landung ansetzt.
Es setzt auf, schießt auf dem Rollfeld an uns vorbei, kommt fast zum Stehen. Rollt dann wieder los, langsam, unerträglich langsam, auf uns zu. Dann hat es seine korrekte Parkposition gefunden und steht still. Ich versuche, durch die kleinen Fenster irgendetwas zu erkennen, was natürlich idiotisch ist. Aber ich weiß, dass Philipp irgendwo da drinnen ist, und das ist alles, was ich wissen muss.
Schön, dass du wieder da bist, denke ich. Schön, dass du wieder da bist.
Wir stehen da, eine endlos lange Zeit, zumindest empfinde ich es so, aber noch nicht einmal Leo drängelt oder quengelt, auch er schaut nur angespannt.
Dann öffnet sich die Tür des Flugzeuges. So unendlich langsam. Mein Herz bleibt beinahe stehen, ich merke, dass ich die Zähne so fest zusammenbeiße, dass mein Kiefer knackt, ich versuche, meine Zahnreihen voneinander zu trennen, es gelingt mir nicht. Da sind sie. Da sind Menschen. Philipp, wo ist Philipp? Ich streiche mir eine nicht existente Haarsträhne hinters Ohr. Dann ist die erste Bewegung an der Tür zu sehen. Ich erstarre vollkommen, während um mich herum die Hölle losbricht. Blitzlichtgewitter und Rufe, Gedrängel und Geschubse, auch auf mich sind Kameras gerichtet, auch nach mir rufen die Fotografen. Ich ignoriere das vollkommen, ich halte meinen Sohn an der Hand, mein Blick ist auf die Tür des Flugzeuges gerichtet, ich werde das jetzt nicht verpassen, ich werde diesen Moment nicht verpassen, in dem Philipp durch diese Tür tritt, zurück in mein Leben. Mein Blick ist starr auf die Flugzeugtür gerichtet, und als sich für einen kurzen Augenblick lang gar nichts tut und ich schon denke, dass alles nur ein Irrtum war, dass irgendetwas furchtbar schief gegangen ist, dass Philipp sich gar nicht in diesem Flugzeug befindet, dass dieses Flugzeug leer ist, keine Piloten, keine Crew, keine Passagiere, ein Geisterflug – da geschieht es. Eine kleine Gruppe von Menschen tritt nach und nach durch die Tür und steigt die Treppe zum Rollfeld herab. Ich spüre, wie sich mein Herzschlag beschleunigt, immer schneller wird. Sie kommen. Erst eine große, blonde Frau im schwarzen Kostüm, nach ihr ein dunkelhaariger Mann in Jeans und Jackett, anschließend ein Mann um die Sechzig im grauen Anzug, danach eine seltsam alterslose Frau mit kurzem, schlohweißem Haar, danach eine Stewardess, dann noch eine, und noch eine, dann ein Mann und eine Frau, beide in Pilotenuniformen. Meine Nerven machen das nicht mehr lange mit. Wo ist Philipp? Ich versuche, ganz ruhig zu atmen, während die kleine Gruppe das Rollfeld betritt, ich sage mir, dass ich sieben Jahre gewartet habe und jetzt auch noch ein paar Sekunden mehr ertragen kann. Nehme kaum wahr, wie die Rufe der Fotografen und Journalisten immer lauter werden. In mir, im Auge des Sturms, ist es ruhig. Ich ignoriere die Menschen um mich herum, ich ignoriere die Truppe, die auf uns zukommt, mein Blick ist auf die Kabinentür gerichtet.
Und dann passiert es. Der Anblick ist so banal, so alltäglich, dass ich im ersten Moment gar nicht begreife, was es bedeutet. Die Kabinentür wird geschlossen. Die Treppe wird weggefahren.
Ich runzle die Stirn. Jemand hat die Kabinentür geschlossen, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, das ist das Flugzeug, das Philipp bringen sollte, aber Philipp ist noch nicht ausgestiegen, und nun hat jemand die Kabinentür geschlossen, und jemand hat die Treppe weggefahren, und wie soll Philipp denn nun herauskommen aus der verdammten Maschine? Ich starre die geschlossene Kabinentür an. Kein Philipp. Kein Philipp. Kein Philipp.
Jemand fasst mich am Ellbogen, ich spüre die Berührung nur leicht, dennoch zucke ich zusammen. Die kleine Gruppe ist bei uns angekommen, widerwillig wende ich meinen Blick von der Kabinentür ab und den Menschen vor mir zu.
Wo ist Philipp?
Warum war er nicht an Bord?
Was ist mit ihm?
Ist ihm etwas zugestoßen?
Ihm kann doch nichts zugestoßen sein, das geht doch nicht, nicht nach allem, was war, nicht nach allem, was er überstanden hat.
Der dunkelhaarige Mann und die große, blonde Frau haben uns fast erreicht. Jemand sagt etwas zu mir, ich verstehe nicht, merke erst jetzt, wie laut und chaotisch es um uns herum zugeht. »Da ist er«, wiederholt der Jemand neben mir.
Ich begreife nicht, was er meint, folge seinem Blick, ratlos, verstört. Die Rufe der Fotografen werden lauter, Herr Petersen, Herr Petersen! Und ich verstehe noch immer nicht, denn Herr Petersen, das ist Philipp, Frau Petersen, das bin ich, ich habe meinen Mädchennamen in einem Stein-Schere-Papier-Spiel kurz vor unserer Hochzeit verloren. Herr Petersen, Herr Petersen!, brüllen die Journalisten. Und in dem Moment hebt der fremde Mann mit den dunklen Haaren links vor mir grüßend den Arm, winkt kurz in Richtung der Pressefotografen – dann wendet sich seine Aufmerksamkeit mir zu. Ich spüre die Blicke, die auf mir lasten. Und kann nur dastehen. Begreife noch immer nichts. Spüre nur, dass etwas von mir erwartet wird, ein Satz, eine Reaktion, irgendwas. Aber ich kann nur dastehen. In meinem Kopf summt es. Hier läuft etwas entsetzlich schief. Mächtig schief. Ich stehe da, die Schultern hochgezogen, als wollte ich mich vor einem Sturm schützen, den nur ich spüren kann. Der Jemand neben mir überbrückt mein Schweigen, sagt: »Herr Petersen. Mein Name ist Wilhelm Hansen. Im Namen des ganzen Teams möchte ich Ihnen sagen: Willkommen daheim.«
Und der Mann sagt: »Vielen Dank, Herr Hansen.«
Nur das. Vier Worte.
Seine Stimme ist leise und schnarrend. Es ist die Stimme eines Fremden. (…)

Melanie Raabe wurde 1981 in Jena geboren und wuchs in einem 400-Seelen-Dorf in Thüringen und einer Kleinstadt in NRW auf. Sie studierte Medienwissenschaft und Literatur in Bochum. Jetzt lebt sie in Köln – als Journalistin, Drehbuchautorin, Bloggerin, Performerin und Theaterschauspielerin. Sie betreibt ihren eigenen Interview-Blog (www.biographilia.com) und erhielt mehrere Preise für ihr Schreiben. Die Rechte an ihrem Roman "Die Falle" wurden bereits vor Erscheinen international verkauft, u.a. nach Frankreich, Italien, die Niederlande, Spanien und das englischsprachige Ausland.
Die berühmte Bestsellerautorin Linda Conrads lebt sehr zurückgezogen. Seit elf Jahren hat sie ihr Haus nicht mehr verlassen. Als sie im Fernsehen den Mann zu erkennen glaubt, der vor Jahren ihre Schwester umgebracht hat, versucht sie, ihm eine Falle zu stellen - Köder ist sie selbst.
„Ein wirklich raffinierter, spannender Plot, und dazu die Fähigkeit der Autorin, ebenso subtil wie präzise die Gedankenwelt ihrer Protagonisten wieder zu geben: Ich habe „Die Falle“ von Melanie Raabe in einem Zug gelesen!“ - Charlotte Link