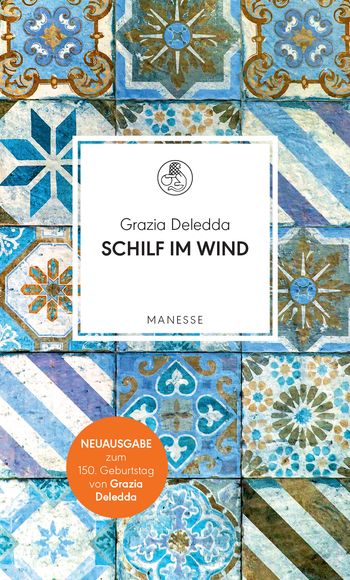Rezension zu
Schilf im Wind
Eine nur scheinbar archaische Erzählung, sensibel und voller starker Bilder. Schilf im Wind“ von Grazia Deledda.
Von: Sören Heim„Schilf im Wind“ von Grazia Deledda habe ich dank des Artikels im Blog Lesestunden entdeckt. Die sardinische Autorin zahlreicher Romane, die Land und Leute ihre Heimat lebendig werden lassen, ist immerhin Literaturnobelpreisträgerin und ich würde behaupten den meisten deutschen Leserinnen und Lesern ähnlich unbekannt wie mir. Das ist ein interessantes Phänomen bezüglich italienischer Autorinnen und Autoren, auf das ich schon in meinem Text über Luigi Pirandello hingewiesen habe. Abseits von Umberto Eco, Fo und den großen Rennaissance-Klassikern ist die oft herausragende italienische Literatur, immerhin beinahe ein Nachbarland Deutschlands, hier kaum bekannt und höchstens in Auszügen veröffentlicht. Verga, Montale, selbst Lampedusa – wer kennt diese Namen? „Schilf im Wind“ ist ein Roman, der auf den ersten Blick vor allem von seiner sprachlichen Gestaltung lebt. Dichte bildhafte Beschreibungen von Landschaft, ein fast malerischer Einsatz von Licht und Schatten. Ein pittoreskes, manchmal leicht morbide wirkendes Verhältnis zu Gebäuden, die ob bewohnt oder unbewohnt oft im Verfall begriffen sind. Derbe Dörflichkeit, die zwischen christlichem-, Volksglauben und knallharter brutaler Berechnung schwankt. Ein ländliches Leben zwischen Abgeschiedenheit, Markttagen und Volksfesten. Doch verliert sich der Text zum Glück nicht komplett in Beschreibungen und Stimmungen, dafür ist er dann doch ein Stück zu lang, sondern erzählt, sogar relativ stringent, eine Geschichte, die nach einem langsamen Start gerade noch rechtzeitig in Fahrt kommt. Die Geschichte ist recht einfach: Drei ältere Schwestern (wobei alt – zumindest die jüngste ist in ihren Dreißigern) bewirtschaften ein altes Landgut mit ihrem Diener Efix. Einst gab es eine vierte Schwester, doch die ist aufs Festland und in die Welt geflohen. Ihre Briefe hat man nie beantwortet, doch nun nimmt man ihren Sohn Giacinto auf dem Gut auf. Der scheint Geld zu haben, tanzt, spielt und trinkt gerne und verliebt sich in eine junge Frau vom Dorf. Doch schließlich kommt raus: Das Geld hat er sich bei einer Wucherin im Dorf geliehen und dafür das Gut verpfändet. Das Nachwort erklärt: Zwar gebe es einige Hinweise, dass die Geschichte in der frühen Moderne spiele, doch könne man ansonsten gut glauben, sie handele noch vom Mittelalter. Ich denke das stellt das im Roman entfaltete Verhältnis von Moderne zu Dörflichkeit ein wenig zu kalt. Ja, die Dorfbewohner leben wohl noch im großen und ganzen so, wie man vor ein paar hundert Jahren gelebt hat. Aber vielleicht doch nicht wirklich. Die kleinen Hinweise auf die Moderne sind doch so breit gestreut, dass sie alle Lebenssphären durchdringend. Da sind der Türkei- und der Libyenkrieg, über die immer mal wieder gesprochen wird und deren Ende und Ergebnisse den Sarden durchaus nicht ganz unwichtig scheinen. Da sind die Fahrräder, die man im Großen und Ganzen den Pferden vorzieht. Zumindest der Erzähler weiß, was ein Kino ist. Das sollte dann vielleicht unseren Blick auch auf die teils sehr theatralische und effektvolle Inszenierung von Konflikten und Szenen durchaus mitbestimmen. Das Alte reibt sich am Neuen, im Kleinen aber nicht zuletzt dann eben auch in der zentralen Geschichte, deren Konflikte rund um Schulden und Geldverleih ebenso modern ist und das altertümliche Dorf aufwühlt wie zuvor die Flucht der Mutter des Protagonisten in die Stadt. Und nicht zuletzt holt hier sozusagen das Imperium, als das Sardinien Italien begreift, mit seinen Verwicklungen die Peripherie ein. Während gleichzeitig das Dorf gegenüber dem Landgut noch einmal eine ähnliche Rolle ausübt, hier versucht der große Mann des Dorfes sich das Landgut qua finanzkapitalistischer Ränkespiele einzuverleiben. Und überhaupt: Dass auf diesem drei Frauen alleine leben und es mehr oder minder verfallen lassen, wie man auch die kleine Kirche verfallen lässt, das scheint mir thematisch und bildlich durchaus eher ein moderner Topos zu sein. Und auch wenn Deledda offiziell dem Naturalismus, genauer dem Verismus zugerechnet wird, bezüglich der Sprache und Bildsprache etwa liegen Welten zwischen „I Malavoglia“ und „Schilf im Wind“. Wie gesagt: Deledda setzt Licht und Schatten fast wie eine Malerin ein. So entstehen Passagen, die ich impressionistisch nennen würde: “Bei Anbruch des Tages machte sich Efix auf den Weg ins Dorf. Die Nachtigallen sangen, und das ganze Tal lag goldfarben da, in einem Gold, das durch die Spiegelung des lichten Himmels bläulich schimmerte. Hier und da zeichnete sich die Silhouette eines Fischers ab, wie doppelt gemalt, reglos auf dem Grün des Ufers und im Grün des stehenden Gewässers zwischen den weißen Kieselsteinen.” Anderen wohnt noch die Gewalt der Spätromantik inne, doch in einer Expressivität, die man ebenfalls modern zu nennen geneigt ist: „Die Straße führte bis zum Dorf ständig bergauf, und er wanderte langsam auf ihr dahin, weil er im vorigen Jahr das Sumpffieber gehabt und eine große Schwäche in den Beinen zurückbehalten hatte. Hin und wieder blieb er stehen und blickte auf das Gut zurück, das leuchtendgrün zwischen den beiden Feigenhecken ruhte; und die Hütte dort oben, die schwarz zwischen dem Blaugrün des Schilfrohrs und dem Weiß des Felsgesteins nistete, erschien ihm wie ein Nest – ein wirkliches Vogelnest. Jedesmal, wenn er fortging, betrachtete er sie so, halb zärtlich und halb traurig, ganz wie ein Vogel, der in die Ferne zieht (…) Klein und schwarz schreitet Efix in die strahlende Helle hinein. Die schrägen Sonnenstrahlen fluten leuchtend über das Land; jede Binse trägt ein Silbergespinst, aus jedem Wolfsmilchgebüsch steigt ein Vogelruf; und dort winkt auch schon der grün und weiß gescheckte, von Schatten und Sonnenstreifen durchfurchte Kegel des Galteberges, und an seinem Fuße ruht das kleine Dorf, das nur aus Schutt und Trümmern zu bestehen scheint: aus den Resten der alten Römerstadt (…) Aber je höher Efix stieg, desto öder und verlassener wurde es um ihn her, und zu allem Überfluß ragten dort am Straßenrand, im Schatten des Berges, zwischen dichtem Brombeer- und Wolfsmilchgestrüpp, auch noch die Überreste eines alten Kirchhofs und die zerfallene Basilika düster in den Himmel. Die Straßen waren wie ausgestorben, und die Felsen auf der Bergkuppe schimmerten wie Leichensteine ins Land.“ Zuletzt gibt es Passagen, die durchaus einen kraftvoll expressionistischen Eindruck hinterlassen und die Farben regelrecht in die Figuren hineinbiegen: „Eines Abends, im Juli, saß Noemi wie so oft im Hof und nähte. Der Tag war sehr schwül gewesen, und der graublaue Himmel war noch verschleiert wie vom Aschenregen eines fernen Brandes, dessen flammendroter Schein allmählich im Westen verglomm. Die nun schon in voller Blüte prangenden Feigensträucher brachten eine goldene Tönung in das eintönige Grau der Gärten, und dort hinter dem eingestürzten Kirchturm schimmerten die Granatapfelbäume Don Predus, wie gesprenkelt von Blut. Noemi fühlte tief in sich all dieses Grau und Rot. Die Wehmut, die sie jedes Jahr im Frühling beschlich, verlor sich heuer nicht mit dem Nahen des Sommers; nein, von Tag zu Tag lockte ein heftiges Verlangen nach Einsamkeit sie immer gebieterischer in die Stille, trieb sie, sich zu verstecken und sich hemmungslos ihrem Gram zu überlassen, wie eine Kranke, die nicht mehr auf Genesung hofft.“ Und es ist hervorzugeben: Diese Varianten der Bildgestaltung beißen sich nicht, sondern sind tatsächlich jeweils passende Varianten eines Gesamtstils, der sich dabei regelmäßig an die Stimmungslage der jeweiligen Fokus-Chraktere anschmiegt. Kritikpunkte: Die Geschichte kommt tatsächlich wie gesagt etwas langsam in Fahrt. Auch den Figuren fehlt diese absolute Kraft, die man etwa bei Dostojewski oder Thomas Mann findet, sodass sie nicht ganz fähig sind, durch Passagen der Spannungsarmut mitzutragen. Mir persönlich werden die Konflikte, die gut angelegt sind, zu früh und zu harmonisch aufgelöst. Dagegen kommt dem Roman die Konstruktion, die, zwar in der dritten Person, die Wahrnehmung der Welt größtenteils durch die Augen des Knechts Efix filtert, dem Text allerdings sehr zugute. Dieser Blick vermittelt uns eine relativ nahe, doch ausreichend distanzierte Perspektive auf die Verhältnisse und vermeidet zugleich die alte Problematik des auktorialen Erzählens von Geschichten, deren Konflikte sich vor allem daraus speisen, dass einige Charaktere mehr wissen als andere und viele davon mehr als die Leserschaft: Die Frage nämlich, warum der angeblich allwissender Erzähler seine Informationen immer so willkürlich preisgibt. Überhaupt ist es eine seltene Perspektive: Die eines Dienenden als mehr als gleichwertigen Protagonisten. Denn am Ende ist „Schilf im Wind“ weit mehr die Geschichte des Efix als die Giacintos und seiner Verwandschaft. Bei ihm sind unsere Emotionen durch den Text hindurch bis zum Schluss. „Schilf im Wind“ ist ein im Großen und Ganzen starker Roman, der durch seine Bilder noch etwas mehr überzeugt als durch seine Erzählung, der aber doch seine Welt von einer ausreichend überzeugenden Erzählung tragen lässt um nicht zu langweilen.
Wir stellen nicht sicher, dass Rezensent*innen, welche unsere Produkte auf dieser Website bewerten, unsere Produkte auch tatsächlich gekauft/gelesen haben.